Martin Künzi war kein Statthalter, der im Hintergrund wirkte. Er war präsent, bestimmend, oft erklärend – und immer überzeugt davon, auf der richtigen Seite des Rechts zu stehen. Wer ihm in den vergangenen Jahren begegnete, medial oder administrativ, traf auf einen Mann, der sein Amt nicht als moderierende Schnittstelle verstand, sondern als Durchsetzungsposition. Als jemand, der wusste, wie die Verwaltung zu funktionieren hat – und der diesen Wissensvorsprung auch ausspielte. Dies ist der zweite Teil unserer Serie über den Berner Bauskandal «Brünig Lodge – Wie ein Bauverfahren ein Leben zerstörte».
Diese Haltung zeigte sich besonders deutlich im Fall Ruben Anderegg. Künzi trat nicht als neutrale Aufsichtsbehörde auf, sondern als prägende Figur, die das Verfahren strukturierte, blockierte und verschleppte– je nach Sichtweise. Drei Baugesuche, 24 Verfügungen, baupolizeiliche Interventionen, ein informeller Augenschein und eine scharfe Wortwahl in den Akten zeugen davon. Alles trug seine Handschrift. Und alles folgte einem Muster, das Kritiker später als machtbesessen übergriffig, formalistisch und persönlich gefärbt bezeichneten.
Künzi liess nie Zweifel daran, dass er im Recht sei. In Interviews, Stellungnahmen und Medienreaktionen trat er belehrend, präzise und abwehrend auf. Der Vorwurf der Behördenwillkür? Für ihn unhaltbar. Die Kritik an der Verfahrensdauer? Ein Missverständnis. Die Existenzfolgen für Anderegg? Nicht sein Problem, sondern die Konsequenz fehlender Geduld und des falschen Verhaltens des Bauherrn. Künzi argumentierte stets aus der Perspektive der Normen – nicht aus der Perspektive der Wirkung.
Gerade das machte ihn angreifbar
Denn während Künzi darauf pochte, korrekt gehandelt zu haben, zerfiel auf der anderen Seite eine wirtschaftliche Existenz. Anderegg verlor nicht nur seine Brünig Lodge, sondern auch Vermögen, Reputation und jahrelang Lebensenergie. Was für den Statthalter ein „sauber geführtes Verfahren“ war, wurde für den Unternehmer zu einer Zermürbungstaktik mit realen und irreversiblen Folgen. Diese Diskrepanz – zwischen formaler Rechtmässigkeit und faktischer Vernichtung – wurde zum Kern der Kritik.
Medial trat Künzi immer wieder genau dort auf, wo diese Spannung sichtbar wurde. Im KASSENSTURZ geriet er ins Zentrum der Kritik, weil ein Baurechtsexperte öffentlich Zweifel an seiner Neutralität und an der Kompetenzabgrenzung seines Handelns äusserte. Anstatt selbstkritisch zu reflektieren, reagierte Künzi mit einer scharfen Gegenoffensive: Er korrigierte, relativierte und verwies auf Zuständigkeiten sowie auf das Amt für Gemeinden und Raumordnung. Das Muster war stets dasselbe: Das System ist korrekt – der Kritiker irrt.
Die anderen Fälle
Auch in anderen Fällen zeigte sich diese Haltung. Sei es in der Debatte um illegal umgebaute Alphütten im Berner Oberland, in Aufsichtsfällen gegenüber Gemeinden oder später bei der juristisch hoch umstrittenen Airbnb-Initiative auf dem Bödeli. Immer stand Künzi auf der Seite der formalen Ordnung, immer entschied er strikt und immer erklärte er öffentlich, warum seine Linie die einzig richtige sei. Andre empfanden es als überheblich, unnahbar und patriarchalisch.
Was sich zunehmend verfestigte, war das Bild eines Statthalters, der sich selbst als letzte Instanz verstand. Der nicht vermittelte, sondern entschied. Der nicht moderierte, sondern durchsetzte. Er verstand Kritik nicht als Warnsignal, sondern als Angriff auf seine Autorität. Alle die es wagten ihn öffentlich zu kritisieren, wurden mit Strafanzeigen eingedeckt und versucht mundtot zu machen – so auch die Plattform J und Ruben Anderegg mit dem Artikel «Die rote Linie wurde überschritten» Die Gemeinden hatten Angst, bei der periodischen Überprüfung von Martin Künzi sanktioniert zu werden. Gerade in einem Amt, das zwischen Bürgern, Gemeinden und Kanton vermitteln sollte, wirkte diese Haltung zunehmend fehl am Platz.
Dass Martin Künzi schliesslich abgewählt wurde, kam für viele Beobachter nicht überraschend. Die Wahl war weniger ein politischer Richtungsentscheid als ein Vertrauensentzug. Es gab zu viele Fälle, zu viel mediale Kritik und zu wenig Selbstkorrektur. Die Abwahl wirkte wie das nachträgliche Urteil über eine Amtsführung, die formal korrekt sein mochte – aber menschlich und institutionell an Akzeptanz verloren hatte.
Für Ruben Anderegg kommt dieses Urteil zu spät. Während Künzi das Amt verlassen hat, kämpft Anderegg weiter: um Schadenersatz in Millionenhöhe, um seinen Ruf und um die Anerkennung dessen, was ihm widerfahren ist. Sollte der Kanton Bern tatsächlich haftbar gemacht werden, werden es nicht die damaligen Entscheidungsträger zahlen, sondern die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Auch das ist Teil dieses Porträts: Die Verantwortung ist personalisiert, die Folgen sind kollektiv.
Rückblickend drängt sich eine unbequeme Frage auf: War Martin Künzi der falsche Mann auf diesem Posten? Nicht weil er das Recht missachtete – sondern weil er es zu eng und zu absolut, zu selbstbezogen auslegte. Der Fall Anderegg zeigt exemplarisch, was passiert, wenn Macht, Überzeugung und fehlende Demut zusammenkommen. Und es macht deutlich, dass ein Rechtsstaat nicht nur korrekte Entscheidungen braucht, sondern auch Haltung, Augenmass und Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Menschen, die ihm ausgeliefert sind.
Titelbild: Foto: PD / Jost von Allmen: Regierungsstatthalter Martin Künzi, 1963, Interlaken, SP
Bild unten: Brünig Lodge und Ruben E. Anderegg, Meiringer Unternehmer

Zu eng, zu formalistisch und ohne ausreichendes Augenmass
Der Fall Anderegg ist juristisch nicht deshalb heikel, weil das Recht angeblich ignoriert worden wäre, sondern weil es zu eng, zu formalistisch und ohne ausreichendes Augenmass angewendet wurde.
Aus verwaltungs- und verfassungsrechtlicher Sicht lassen sich mehrere Punkte benennen, an denen der Regierungsstatthalter Martin Künzi anders hätte handeln müssen, ohne das Recht zu verletzen.
1. Verhältnismässigkeit nicht nur formell, sondern auch materiell prüfen
Das Verhältnismässigkeitsprinzip ist kein abstrakter Lehrsatz, sondern verlangt eine Abwägung der konkreten Auswirkungen staatlichen Handelns. Ein Statthalter hätte nicht nur prüfen müssen, ob ein Verfahren rechtlich korrekt geführt wird, sondern auch, ob Dauer, Dichte der Verfügungen und Eskalationsstufen noch in einem vernünftigen Verhältnis zum Bauvorhaben stehen.
Vier Jahre, 24 Verfügungen und parallele Verfahren mögen einzeln erklärbar sein – in der Summe sind sie es nicht mehr.
2. Trennung von Rollen strikt einhalten
Ein Regierungsstatthalter ist zugleich Aufsichtsbehörde, Entscheidungsinstanz und Koordinator. Gerade deshalb verlangt das Recht eine klare Rollentrennung.
Wer baupolizeiliche Massnahmen anstösst, informelle Augenscheine durchführt und später über dieselbe Sache entscheidet, riskiert den Anschein fehlender Unvoreingenommenheit – selbst dann, wenn formell keine Befangenheit vorliegt.
Juristisch gilt: Nicht nur tatsächliche Parteilichkeit ist problematisch, sondern bereits ihr objektiver Anschein.
3. Informelle Eingriffe vermeiden oder strikt verfahrensrechtlich absichern
Der informelle Augenschein im Fall Anderegg war kein nebensächliches Detail. Solche Schritte sind nur dann zulässig, wenn sie transparent erfolgen, protokolliert werden und das rechtliche Gehör gewährt wird.
Ein Statthalter hätte entweder:
-
auf informelle Schritte verzichten oder
-
sie formell ankündigen, dokumentieren und den Parteien volle Mitwirkungsrechte einräumen müssen.
Alles andere schwächt die Verfahrensfairness – selbst bei einem rechtlich korrekten Endentscheid.
4. Eskalation steuern statt beschleunigen
Das Verwaltungsrecht kennt keine Pflicht zur maximalen Eskalation. Ein Statthalter hat den Spielraum, deeskalierend zu wirken, insbesondere bei existenziell betroffenen Bauherren.
Im Fall Anderegg wäre es rechtlich möglich – und angezeigt – gewesen,
– Verfahren zu bündeln statt zu fragmentieren,
– Zwischenergebnisse verbindlich zu klären
– und frühzeitig auf eine koordinierte Gesamtlösung hinzuwirken.
Rechtlich erlaubt ist nicht nur das Sanktionieren, sondern auch das Lenken.
5. Existentielle Folgen als Rechtsfaktor anerkennen
Das Verwaltungsrecht kennt keine explizite „Existenzschutz-Klausel“. Die Rechtsprechung verlangt jedoch, dass Behörden schwere wirtschaftliche Folgen in ihre Interessenabwägung einbeziehen.
Ein Statthalter hätte deshalb prüfen müssen, ob sein Vorgehen – kumulativ betrachtet – irreversible Schäden verursacht, die später nicht mehr korrigierbar sind, selbst wenn der Bauherr am Ende Recht erhält.
6. Verantwortung endet nicht bei formaler Rechtmässigkeit
Der zentrale juristische Punkt lautet:
Formell rechtmässiges Handeln kann materiell rechtsstaatlich problematisch sein.
Ein Regierungsstatthalter trägt nicht nur Verantwortung für seine Entscheidungen, sondern auch für die Wirkung des Verwaltungshandelns als Ganzes. Wer sich ausschliesslich hinter Normen, Zuständigkeiten und Fachstellen versteckt, verfehlt den Kern moderner Verwaltungsführung.
Ein anderer Statthalter hätte nicht weniger Recht angewandt, sondern mehr Rechtsstaatlichkeit. Mehr Abwägung. Mehr Distanz zur eigenen Macht. Mehr Sensibilität für die Menschen hinter den Akten. Der Fall Anderegg zeigt exemplarisch, dass nicht jeder Rechtsfehler einklagbar ist. Aber nicht jeder rechtmässige Entscheid ist gerecht. Genau in diesem Spannungsfeld hätte der Regierungsstatthalter anders handeln müssen.
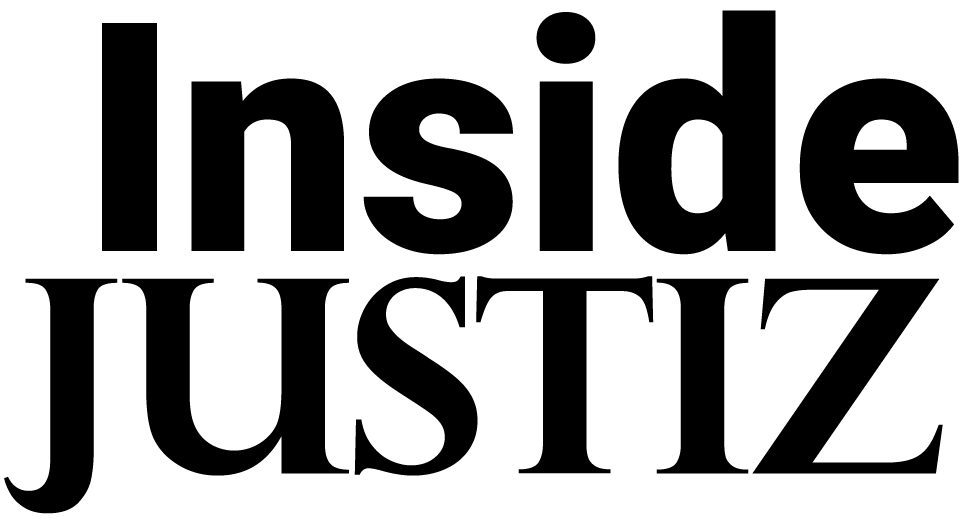
Die Statthalter: Vielerorts kleine Könige ohne wirksame Kontrolle. Feudalistische Strukturen und Haltungen.