Am 17. März 2026 beginnt vor dem Bündner Obergericht die auf zwei Tage angesetzte Berufungsverhandlung gegen den ehemaligen Verwaltungsrichter aus Chur, dem die Vergewaltigung einer Praktikantin im Dezember 2021 vorgeworfen wird. Die drei Richter des Spruchkörpers sind frühere Kollegen des Beschuldigten – es handelt sich um den Vorsitzenden der ersten strafrechtlichen Kammer, Oberrichter Alexander Moses (FDP), sowie die Oberrichterin Ursula Michael-Dürst, Ziers (FDP) und Chiara Richter-Baldassarre (SP).
Alleine das stellt die Unparteilichkeit schon im Vorfeld infrage. Dazu hat das Gericht entschieden, die Öffentlichkeit bei diesem Prozess auszuschliessen, einzig akkreditierte Journalisten sollen zugelassen werden. Diese Information wurde den Medien am Freitag auf Anfrage von INSIDE-JUSTIZ kurzfristig mitgeteilt. Der Schritt dürfte zu weiteren Diskussionen über die Voreingenommenheit und Befangenheit der Bündner Justiz führen.
Im Zentrum steht der Tatvorwurf aus dem Dezember 2021: Der ehemalige Verwaltungsrichter soll seine damals 24-jährige Praktikantin vergewaltigt und sexuell bedrängt haben. Die junge Frau reichte knapp drei Monate später Anzeige ein. Die Bündner Staatsanwaltschaft ermittelte, allerdings mit grosser Zurückhaltung. Forensische Untersuchungen blieben aus, auch Chatverläufe wurden nie offiziell gesichert, Auskunftspersonen erst zwei Jahre später befragt – kein Wunder, konnten sie sich an keine sachdienlichen Beobachtungen mehr erinnern. Die zuständige Staatsanwältin Corina Columberg war mit dem beschuldigten Richter zudem «per Du».
Erst als INSIDE JUSTIZ und andere Medien ein Jahr nach der mutmasslichen Vergewaltigung über die stockende Untersuchung berichteten, trat der Richter von seiner Funktion zurück. Die Justizkommission des Grossen Rates hatte zwar von den Vorwürfen gewusst, aber keine Dringlichkeit gesehen. Ein mutmasslicher Vergewaltiger als amtierender Richter? In der Bündner Justizkaste schien sich kaum jemand daran zu stören.
Erstinstanzliches Urteil
Im November 2024 urteilte das Regionalgericht Plessur unter dem Vorsitz von Bettina Flütsch erstinstanzlich: Der ehemalige Verwaltungsrichter wurde in mehreren Punkten für schuldig befunden – Vergewaltigung, sexuelle Belästigung, Drohung – und zu 23 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung (plus Geldstrafe) verurteilt. Das Strafmass fiel deutlich unter dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft aus. Sie hatte 30 Monate verlangt, womit der Beschuldigte mindestens einen Teil der Strafe hätte absitzen müssen. Das Gericht begründete seine Milde unter anderem damit, dass der frühere Verwaltungsrichter Ersttäter und medial vorverurteilt worden sei. Dies, obwohl sein Name in keinem Medienbericht je genannt worden war.
Unter dem Motto «Die Scham muss die Täterseite wechseln» fand schon nach der mündlichen Hauptverhandlung eine Demonstration von rund 200 Personen statt. Vielen Menschen in Graubünden war die versuchte Täter-Opfer-Umkehr sauer aufgestossen, die an der Hauptverhandlung von einem der Richter ausging: Er hatte vom Opfer wissen wollen, warum es nicht einfach die Beine fest zusammengepresst haben, um die Vergewaltigung zu vermeiden. Die WOZ schrieb von «Fassungslosigkeit gegenüber der Bündner Justiz».
Zum nächsten Kopfschütteln führte die Verzögerung bei der schriftlichen Urteilsbegründung, die erst Ende Oktober 2025 vorlag, fast ein Jahr nach der mündlichen Urteilsverkündung – das Gesetz schreibt eine Frist von maximal 60 Tagen vor. Wie kann sich das Regionalgericht Plessur in einem Fall, der unter schweizweiter Beobachtung steht, einen solchen Faux-pas leisten, fragen sich Strafrechtler bis heute.
Medien und Juristen kritisierten aber auch den Inhalt der schriftlichen Urteilsbegründung. Insbesondere etwa, dass das Gericht das Verschulden des Vergewaltigungsrichters als «gering» einstufte. Kommentatoren sprachen von einem «Armutszeugnis für die Bündner Justiz» und einer Justiz «mit Beisshemmung». Viele verwiesen auch damals schon auf eine ausgeprägte Vetterliwirtschaft: Zu viele Verfahrensbeteiligte kannten den Angeklagten aus dem kantonalen Justizbetrieb, was einen Befangenheitsverdacht aufkommen liess, der nie ausgeräumt werden konnte.
Ausschluss der Öffentlichkeit widerspricht Verfassungsdogmatik
Der jüngste Clou der Bündner Richterkaste dürfte diesen Eindruck noch einmal verstärken: Welchem anderen Zweck als dem Schutz des ehemaligen Richterkollegen vor den kritischen Blicken der Bündner Öffentlichkeit könnte es dienen, wenn dieser unter Ausschluss der Öffentlichkeit und in Abkehr von einem wichtigen Verfassungsgrundsatz aussagen darf? Der Eindruck, dass der ehemalige Kollege hier eine Vorzugsbehandlung erfahren soll, liegt auf der Hand.
Zumal der jüngste Entscheid des Obergerichts juristisch alles andere als zwingend ist. Gemäss Art. 69 der eidgenössischen Strafprozessordnung ist die Hauptverhandlung grundsätzlich öffentlich. Grundlage dafür bilden mehrfach formulierte Grundsätze aus der Verfassung, etwa Art. 30 Abs. 3 der Bundesverfassung, aber auch überstaatliches Recht, wie Art. 6 Ziff. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention EMRK oder Art. 14 Abs. 1 UNO Pakt II.
Herrschende Lehre und Praxis legen aus rechtsstaatlichen Gründen denn auch grosses Gewicht auf die Justizkontrolle, welche durch die öffentlichen Verhandlungen geschaffen wird: Die Justiz in der Schweiz dürfe keine Geheim- oder Kabinettsjustiz sein, hatte auch das Bundesgericht immer wieder klar gemacht, beispielsweise, wenn Gerichte versucht hatten, den Spruchkörper anonym zu halten, damit nicht nachvollziehbar war, welche Richter an einem Entscheid mitgewirkt hatten.
Nur die Öffentlichkeit der gerichtlichen Arbeit biete Gewähr, dass sich die Bürgerinnen und Bürger ein Bild davon machen könnten, ob die Justiz korrekt arbeite und nachvollziehbare Urteile fälle, so die herrschende Praxis des Bundesgerichts und Lehre. «Die demokratische Kontrolle durch die Rechtsgemeinschaft soll Spekulationen begegnen, die Justiz benachteilige oder privilegiere einzelne Prozessparteien ungebührlich oder die Ermittlungen würden einseitig und rechtsstaatlich fragwürdig geführt«, schrieb das Bundesgericht zum Beispiel in Urteil 7B_61/2022 vom 25. Juni 2024. – Als ob es in dem vorliegenden Bündner Fall nicht ganz genau darum ginge.
Namhafte Juristen machen notabene immer wieder darauf aufmerksam, dass dieses Prinzip bereits heute arg in Frage gestellt sei, weil in der Schweiz vor Gericht (anders als z.B. in Deutschland) nicht das Unmittelbarkeitsprinzip gelte. So müssen im Schweizer Hauptverfahren zum Beispiel nicht alle Zeugen unmittelbar und direkt vom Gericht in der öffentlichen Gerichtsverhandlung angehört werden. Das Gericht kann sich auch damit begnügen, einfach die schriftlichen Einvernahmeprotokolle heranzuziehen und auf diese abzustützen. Nur: Der interessierten Öffentlichkeit sind diese Akten nicht zugänglich.
Verhältnismässigkeit müsste vom Gericht begründet werden
Ein völliger Ausschluss der Öffentlichkeit ist deshalb schon per se nur in engen Grenzen möglich: Art. 70 der eidgenössischen Strafprozessordnung erlaubt den Ausschluss, wenn «schutzwürdige Interessen einer beteiligten Person, insbesondere des Opfers, dies erfordern». In aller Regel entscheidet ein Gericht in diesem Sinne, wenn das Opfer einen entsprechenden Antrag stellt. Auf Nachfrage von INSIDE-JUSTIZ, ob das der Fall sei, hat das Obergericht die Antwort verweigert. Die Verteidigerin des Beschuldigten, Rechtsanwältin Tanja Knodel, schreibt INSIDE JUSTIZ, von Seiten der Verteidigung sei kein entsprechender Antrag gestellt worden.
Im Basler Kommentar zur Strafprozessordnung halten die Autoren Urs Saxer, Mascha Santschi Kallay und Simon Thurnheer zum Ausschluss der Öffentlichkeit fest: «Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu wahren: Publikumsöffentlichkeit ist die verfassungsrechtliche Regel, der Öffentlichkeitsausschluss ist die legitimationsbedürftige Ausnahme.»
Die Legitimationsgrundlage für den Ausschluss der Öffentlichkeit im Bündner Vergewaltigungsfall bleibt äusserst dünn. Der vollständige Ausschluss der Öffentlichkeit ergibt schon deshalb keinen Sinn, weil ein solcher Schritt im erstinstanzlichen Verfahren vor Regionalgericht Plessur nicht erfolgt war. Dort war das Publikum lediglich von der Befragung des Opfers ausgeschlossen worden, nicht aber von den weiteren Verhandlungspunkten – beispielsweise der Befragung des Beschuldigten oder den Plädoyers von Staatsanwaltschaft, den Opferanwälten und der Verteidigung. Warum das vor der zweiten Instanz nun anders sein soll, vermag Obergerichts-Sprecher Schmid nicht zu begründen und schreibt lediglich: «Es entspricht überdies gängiger Praxis nicht nur des Obergerichts des Kantons Graubünden, bei angeklagten Sexualdelikten mit Opfern die Öffentlichkeit aus Gründen des Opferschutzes von der Verhandlung auszuschliessen (siehe Art. 70 Abs. 1 StPO). Gerade bei Delikten gegen die sexuelle Integrität, wo intimste Details erörtert werden müssen, ist ein Öffentlichkeits-ausschuss angebracht.»
Bündner «Automatismus» widerspricht dem Recht
Nur: Soweit das Obergericht mit der «gängigen Praxis» von einem Quasi-Automatismus auslegt, liegt es allerdings ausserhalb der geltenden Rechtspraxis. Das beginnt damit, dass «ein angemessenes Verhältnis zwischen den Gründen für den Ausschluss der Öffentlichkeit und dem Interesse an der öffentlichen Verhandlung bestehen» müsse, wie der Basler Kommentar zur Strafprozessordnung festhält. «Wer den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt, muss darlegen, inwiefern seine schutzwürdigen Interessen durch die Gerichtsöffentlichkeit verletzt würden. Das Gericht hat sodann konkret zu prüfen und abzuwägen, ob solche Interessen bei einer am Verfahren beteiligten Person in einer Weise vorliegen, dass sich ein teilweiser oder gänzlicher Öffentlichkeitsausschluss rechtfertigt.»
Mit anderen Worten: Ein «Automatismus», wie ihn das Bünder Obergericht gemäss eigener Kommunikation zu pflegen angibt, kann nicht in Frage kommen. Zitat Basler Kommentar: «Bei Verfahren in Zusammenhang mit Delikten gegen die sexuelle Integrität muss das Gericht ebenfalls stets eine Abwägung vornehmen. Die geltende Regelung lässt einen Automatismus des Öffentlichkeitsausschlusses auf Antrag des Opfers nicht (mehr) zu.» Und, wohlverstanden: Gemäss den bisherigen Informationen des Obergerichts liegt nicht einmal ein entsprechender Antrag vor.
Bei der Güterabwägung gälte es, die Verhältnismässigkeit zu berücksichtigen: «Der Ausschluss der Öffentlichkeit muss verhältnismässig sein, d. h. geeignet und erforderlich. Zudem muss ein angemessenes Verhältnis zwischen den Gründen für den Ausschluss der Öffentlichkeit und dem Interesse an der öffentlichen Verhandlung bestehen.»
Wie kann man die Wichtigkeit der Verfahrensöffentlichkeit ausgerechnet in diesem Prozess nicht sehen?
Wie ein Gericht bei der Berufungsverhandlung in einem Strafverfahren, das seit Anbeginn dem Makel der Befangenheit durch alle Instanzen hindurch ausgesetzt war und ist, den vollständigen Ausschluss der Öffentlichkeit als angemessen beurteilen kann, lässt sich ausserhalb der Bündner Justizlogik kaum nachvollziehen. Auf eine entsprechende Nachfrage von INSIDE JUSTIZ verweist Gerichtssprecher Stefan Schmid banal darauf, dass die Öffentlichkeit auch im erstinstanzlichen Verfahren von einem Teil der Hauptverhandlung ausgeschlossen gewesen sei. –
Dabei ist genau das der Punkt: Ein Ausschluss des Publikums von der Befragung des Opfers, wie das Regionalgericht Plessur ihn verfügt hatte, entspricht dem Opferschutz und erscheint verhältnismässig. Wie auch weitere Massnahmen, die dafür in Betracht kommen könnten und von Juristen genannt werden: Das Opfer befindet sich z.B. in einem Nebenraum und wird per Videokonferenz-Schaltung befragt, oder im Rahmen einer Einzelsitzung mit Richter/Verteidigung. Diese Methoden schützen das Opfer, ohne jegliche Kontrolle durch die Öffentlichkeit auszuschliessen.
Auf die Befangenheitsproblematik und den Vorwurf der Bevorzugung eines Beschuldigten, wenn ein Gericht über einen ehemaligen Kollegen zu Gericht sitzt, geht das Bündner Obergericht genau so wenig ein wie auf die von Lehre und Praxis geforderte Interessensabwägung, die vorzunehmen das Bündner Obergericht offenbar nicht gewillt ist.
Weitere Irritationen durch die Staatsanwaltschaft
Der Ausschluss der Öffentlichkeit bleibt indes nicht die einzige Irritation in dem Berufungsverfahren. Wie das Bündner Obergericht mitteilt, hat die Staatsanwaltschaft Graubünden ihre Berufung still und heimlich von einer Haupt- in eine Anschlussberufung umgewandelt. Das ist rechtlich zwar korrekt, wirft aber die nächsten Fragen auf.
Eine Anschlussberufung ist quasi einer Hauptberufung angehängt. Wird die Hauptberufung zurückgezogen, was ein Berufungskläger jederzeit tun kann, fällt auch die Anschlussberufung dahin. Konkret und auf den Churer Vergewaltigungsfall bezogen heisst das: Dadurch, dass die Staatsanwaltschaft ihre Hauptberufung zu einer Anschlussberufung an die Berufung des beschuldigten Richters umgewandelt hat, hat sie sich in dessen Abhängigkeit gebracht. Zieht der beschuldigte Richter seine Berufung nämlich zurück und akzeptiert den Schuldspruch und die bedingte Freiheits- und Geldstrafe, ist die Sache aus und vorbei. Die Staatsanwaltschaft hätte in diesem Falle keine Möglichkeit mehr, ein höheres Strafmass zu verlangen – oder dass der Beschuldigte auch noch derjenigen sexuellen Belästigungen schuldig gesprochen wird, von denen ihn die erste Instanz freisprach.
Was hatte die Staatsanwaltschaft still und heimlich zu diesem Schritt bewogen? Auf entsprechende Nachfrage von INSIDE JUSTIZ schreibt Kevin Kobel von der Staatsanwaltschaft Graubünden: «Die Staatsanwaltschaft Graubünden hat sich entschieden, ihre eigenständige Berufung in eine Anschlussberufung umzuwandeln, da der Beschuldigte im Sinne der Anklage schuldig gesprochen wurde, daher nicht noch einmal zwingend über die Schuldfrage befunden werden muss und die Anschlussberufung Gewähr bietet, dass im Fall einer Aufrechterhaltung der Berufung des Beschuldigten auch über das Strafmass ohne Einschränkung entschieden werden kann.»
Staatsanwaltschaft erneut saft- und kraftlos
Auch diese Antwort ist wiederum nur zu Hälfte korrekt: Zum einen ist der Beschuldigte von der ersten Instanz nicht in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Einige sexuelle Belästigungen, die ebenfalls angeklagt waren, hatte die erste Instanz verworfen, weil sie die nötige Intensität nicht für gegeben erachtet hatte. Ob die Staatsanwaltschaft diese Freisprüche ursprünglich überhaupt anfechten wollte, bleibt wohl ihr Geheimnis – denkbar wäre nämlich, dass die Staatsanwaltschaft schon in ihrer Hauptberufung lediglich die Festlegung des Strafmasses angefochten hatte. Dazu Transparenz zu schaffen, hatte sie bislang verweigert: Gegenüber den Medien erklärte sie im November, bei Einreichung der Berufung, die Begründung der Berufungserklärung erfolge erst vor Obergericht.
Missverständlich ist aber auch die Aussage von Kobel, dass «nicht noch einmal zwingend über die Schuldfrage befunden werden muss». Tanja Knodel, die Verteidigerin des Beschuldigten, widerspricht dieser Aussage auf Nachfrage von INSIDE JUSTIZ diametral: «Es ist mir schleierhaft, was die Staatsanwaltschaft Ihnen mitteilen wollte. Wir haben die Sexualdelikte vollumfänglich angefochten, weshalb sich das Obergericht sehr wohl mit der Schuldfrage wird befassen müssen.»
Entscheidend ist wohl das kleine Wörtlichen «zwingend», mit welcher die Staatsanwaltschaft die Sache zu vernebeln versucht. Theoretisch ist nämlich ein Fall denkbar, bei dem die Schuldfrage tatsächlich nicht mehr verhandelt würde. Das wäre ausschliesslich dann der Fall, wenn der Beschuldigte seine Berufung zurückziehen sollte. Damit würde tatsächlich das Urteil der ersten Instanz rechtskräftig und die Schuldfrage nicht noch einmal neu verhandelt. Nur: die Staatsanwaltschaft hätte damit auch jede Chance verspielt, ein höheres Strafmass zu erzielen – sprich: eine unbedingte Freiheitsstrafe. Genau die Strafzumessung war aber derjenige Teil des erstinstanzlichen Urteils, der in der Öffentlichkeit die meiste Kritik erfuhr.
Eine nachvollziehbare Begründung, warum sich die Staatsanwaltschaft derartig defensiv verhält, ist derweil nicht erkennbar.
(Mitarbeit: Roger Huber)
Titelbild: Das Gebäude des Bündner Obergerichts an der Grabenstrasse in Chur

Wieviel Ignoranz ist noch möglich?
Das Bündner Obergericht will also unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die mutmassliche Vergewaltigung seines ehemaligen Richterkollegen beraten. Das kann man nur so interpretieren, dass die Bündner Richter mit Wissen und Willen alles dafür tun, um auch das letzte bisschen Vertrauen der Bündner Bevölkerung in die Arbeit ihrer Justiz zu zerstören. Arroganz und Ignoranz aus Prinzip.
Und das in einem Verfahren, das von Beginn an unter einem schlechten Stern stand und unter Juristen der ganzen Schweiz für Stirnrunzeln und Kopfschütteln sorgt. Beginnend mit der Voruntersuchung durch Staatsanwältin Corina Collenberg, die erst einmal mehrere Monate verstreichen lässt, ohne die nötigen Untersuchungshandlungen vorzunehmen. Sie führt ein Verfahren gegen einen Beschuldigten, mit dem sie per „Du” ist, und dessen Ex auf derselben Staatsanwaltschaft tätig ist.
Als die schweizweite Kritik an derlei viel berglerischer Nähe bei der Bündner Staatsanwaltschaft ankommt, wird beim Obergericht mit einem Vorstoss vorgetragen, den Fall, statt vom Regionalgericht Plessur von einem unabhängig zusammengestellten Spruchkörper beurteilen zu lassen. Das Obergericht wird zum ersten Mal mit dem Fall betraut. Schon hier zeigt sich, dass auch ihm jede Sensibilität für den Eindruck von Befangenheit abgeht, denn er sieht keine Probleme darin, dass das Regionalgericht Plessur den Fall verhandelt. Mit dabei ist unter anderem Hermi Saluz, Richter im Nebenamt und Mitglied der Mitte-Partei, deren Ortspräsident der Beschuldigte einst war. Dass gemäss Recht und Gesetz nicht einmal der Anschein der Befangenheit bei einem Spruchkörper bestehen dürfte – geschenkt!.
Saluz löst prompt den nächsten Justizskandal aus. In der erstinstanzlichen Verhandlung fragte er das Opfer, warum es nicht einfach die Beine zusammengepresst habe, um der Vergewaltigung zu entgehen. Es folgten Rücktrittsforderungen und eine Demonstration von 300 Menschen in Chur, die die richterliche Täter-Opfer-Umkehr für unerträglich erachteten.
Als der ehemalige Richterkollege dann zu einer Freiheitsstrafe von 23 Monaten verurteilt wird – haarscharf an der Grenze dessen, was noch auf Bewährung ausgesprochen werden kann –, überrascht das eigentlich niemanden mehr. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.
Trotz der schweizweiten Beachtung, die der Fall längst hat, nimmt sich das Richtergremium ein Jahr Zeit für die schriftliche Urteilsbegründung. Gesetzlich vorgeschrieben wäre eine Vorlage innerhalb von drei Monaten. Der nächste Bündner Justiz-Flopp.
Und es werden noch mehr folgen, denn wie am Freitag bekannt wird, hat die Staatsanwaltschaft Graubünden ihre Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil still und heimlich in eine Anschlussberufung umgewandelt. Das heisst nichts anderes, als dass sie das Rechtsmittelverfahren vollkommen in die Hände des beschuldigten Richters legt. Zieht er seine Berufung kurz vor der Berufungsverhandlung zurück, was er kann, wäre die Sache erledigt.
Schliesslich die fadenscheinige Begründung des Obergerichts, die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen. Dass in einer Verhandlung über eine Vergewaltigung teilweise um intimste und für ein Opfer beschämende Details gehen kann, bestreitet niemand. Dem Schutz des Opfers kann aber sehr wohl Rechnung getragen werden, ohne die Öffentlichkeit ausschliessen zu müssen. Beispielsweise könnte das Publikum für diejenigen Teile der Verhandlung ausgeschlossen werden, die für das Opfer belastend sind. Eine weitere Möglichkeit wäre, das Opfer in einem Nebenraum per Video-Konferenz zu vernehmen. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Zudem hat das Opfer gemäss den spärlichen Informationen, die das Obergericht preisgibt, gar keinen diesbezüglichen Antrag gestellt. Dabei darf man davon ausgehen, dass die junge Frau, die inzwischen als Rechtsanwältin arbeitet, einen entsprechenden Antrag sehr wohl gestellt hätte, wenn es ihr wichtig gewesen wäre. Womöglich wäre es ihr nach der ganzen Vorgeschichte aber sogar wichtiger gewesen, sich versichert zu wissen, dass die Öffentlichkeit ein kritisches Auge auf das Treiben der Bündner Justiz hat.
Lorenzo Winter
Art. 69 StPO. Öffentlichkeit. Grundsätze
1 Die Verhandlungen vor dem erstinstanzlichen Gericht und dem Berufungsgericht sowie die mündliche Eröffnung von Urteilen und Beschlüssen dieser Gerichte sind mit Ausnahme der Beratung öffentlich.
2 Haben die Parteien in diesen Fällen auf eine öffentliche Urteilsverkündung verzichtet oder ist ein Strafbefehl ergangen, so können interessierte Personen in die Urteile und Strafbefehle Einsicht nehmen.
3 Nicht öffentlich sind:
- das Vorverfahren; vorbehalten bleiben Mitteilungen der Strafbehörden an die Öffentlichkeit;
- das Verfahren des Zwangsmassnahmengerichts;
- das Verfahren der Beschwerdeinstanz und, soweit es schriftlich durchgeführt wird, des Berufungsgerichts;
- das Strafbefehlsverfahren.
4 Öffentliche Verhandlungen sind allgemein zugänglich, für Personen unter 16 Jahren jedoch nur mit Bewilligung der Verfahrensleitung.
Art. 30 BV. Gerichtliche Verfahren
1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2 Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3 Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Art. 70 StPO. Einschränkungen und Ausschluss der Öffentlichkeit
1 Das Gericht kann die Öffentlichkeit von Gerichtsverhandlungen ganz oder teilweise ausschliessen, wenn:
- die öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder schutzwürdige Interessen einer beteiligten Person, insbesondere des Opfers, dies erfordern;
- grosser Andrang herrscht.
2 Ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen, so können sich die beschuldigte Person, das Opfer und die Privatklägerschaft von höchstens drei Vertrauenspersonen begleiten lassen.
3 Das Gericht kann Gerichtsberichterstatterinnen und Gerichtsberichterstattern und weiteren Personen, die ein berechtigtes Interesse haben, unter bestimmten Auflagen den Zutritt zu Verhandlungen gestatten, die nach Absatz 1 nicht öffentlich sind.
4 Wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen, so eröffnet das Gericht das Urteil in einer öffentlichen Verhandlung oder orientiert die Öffentlichkeit bei Bedarf in anderer geeigneter Weise über den Ausgang des Verfahrens.
Art. 6 EMRK. Recht auf ein faires Verfahren
(1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder – soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält – wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
(2) Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig.
(3) Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte:
- innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
- ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
- sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
- Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
- unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
Art.14 UNO-Pakt II.
(1) Alle Menschen sind vor Gericht gleich. Jedermann hat Anspruch darauf, dass über eine gegen ihn erhobene strafrechtliche Anklage oder seine zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen durch ein zuständiges, unabhängiges, unparteiisches und auf Gesetz beruhendes Gericht in billiger Weise und öffentlich verhandelt wird. Aus Gründen der Sittlichkeit, der öffentlichen Ordnung (ordre public) oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft oder wenn es im Interesse des Privatlebens der Parteien erforderlich ist oder – soweit dies nach Auffassung des Gerichts unbedingt erforderlich ist – unter besonderen Umständen, in denen die Öffentlichkeit des Verfahrens die Interessen der Gerechtigkeit beeinträchtigen würde, können Presse und Öffentlichkeit während der ganzen oder eines Teils der Verhandlung ausgeschlossen werden; jedes Urteil in einer Straf- oder Zivilsache ist jedoch öffentlich zu verkünden, sofern nicht die Interessen Jugendlicher dem entgegenstehen oder das Verfahren Ehestreitigkeiten oder die Vormundschaft über Kinder betrifft.
(2) Jeder wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte hat Anspruch darauf, bis zu dem im gesetzlichen Verfahren erbrachten Nachweis seiner Schuld als unschuldig zu gelten.
(3) Jeder wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte hat in gleicher Weise im Verfahren Anspruch auf folgende Mindestgarantien:
- Er ist unverzüglich und im Einzelnen in einer ihm verständlichen Sprache über Art und Grund der gegen ihn erhobenen Anklage zu unterrichten;
- er muss hinreichend Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung seiner Verteidigung und zum Verkehr mit einem Verteidiger seiner Wahl haben;
- es muss ohne unangemessene Verzögerung ein Urteil gegen ihn ergehen;
- er hat das Recht, bei der Verhandlung anwesend zu sein und sich selbst zu verteidigen oder durch einen Verteidiger seiner Wahl verteidigen zu lassen; falls er keinen Verteidiger hat, ist er über das Recht, einen Verteidiger in Anspruch zu nehmen, zu unterrichten; fehlen ihm die Mittel zur Bezahlung eines Verteidigers, so ist ihm ein Verteidiger unentgeltlich zu bestellen, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
- er darf Fragen an die Belastungszeugen stellen oder stellen lassen und das Erscheinen und die Vernehmung der Entlastungszeugen unter den für die Belastungszeugen geltenden Bedingungen erwirken;
- er kann die unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers verlangen, wenn er die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht;
- er darf nicht gezwungen werden, gegen sich selbst als Zeuge auszusagen oder sich schuldig zu bekennen.
(4) Gegen Jugendliche ist das Verfahren in einer Weise zu führen, die ihrem Alter entspricht und ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft fördert.
(5) Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung verurteilt worden ist, hat das Recht, das Urteil entsprechend dem Gesetz durch ein höheres Gericht nachprüfen zu lassen.
(6) Ist jemand wegen einer strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt und ist das Urteil später aufgehoben oder der Verurteilte begnadigt worden, weil eine neue oder eine neu bekannt gewordene Tatsache schlüssig beweist, dass ein Fehlurteil vorlag, so ist derjenige, der auf Grund eines solchen Urteils eine Strafe verbüsst hat, entsprechend dem Gesetz zu entschädigen, sofern nicht nachgewiesen wird, dass das nicht rechtzeitige Bekanntwerden der betreffenden Tatsache ganz oder teilweise ihm zuzuschreiben ist.
(7) Niemand darf wegen einer strafbaren Handlung, wegen der er bereits nach dem Gesetz und dem Strafverfahrensrecht des jeweiligen Landes rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, erneut verfolgt oder bestraft werden.
Art. 19 BetmG
1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
- Betäubungsmittel unbefugt anbaut, herstellt oder auf andere Weise erzeugt;
- Betäubungsmittel unbefugt lagert, versendet, befördert, einführt, ausführt oder durchführt;
- Betäubungsmittel unbefugt veräussert, verordnet, auf andere Weise einem andern verschafft oder in Verkehr bringt;
- Betäubungsmittel unbefugt besitzt, aufbewahrt, erwirbt oder auf andere Weise erlangt;
- den unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln finanziert oder seine Finanzierung vermittelt;
- öffentlich zum Betäubungsmittelkonsum auffordert oder öffentlich eine Gelegenheit zum Erwerb oder Konsum von Betäubungsmitteln bekannt gibt;
- zu einer Widerhandlung nach den Buchstaben a–f Anstalten trifft.
2 Der Täter wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn er:
- weiss oder annehmen muss, dass die Widerhandlung mittelbar oder unmittelbar die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann;
- als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelhandels zusammengefunden hat;
- durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt;
- in Ausbildungsstätten vorwiegend für Jugendliche oder in ihrer unmittelbaren Umgebung gewerbsmässig Betäubungsmittel anbietet, abgibt oder auf andere Weise zugänglich macht.
3 Das Gericht kann in folgenden Fällen die Strafe nach freiem Ermessen mildern:
- bei einer Widerhandlung nach Absatz 1 Buchstabe g;
- bei einer Widerhandlung nach Absatz 2, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und diese Widerhandlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen.
4 Nach den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 ist auch strafbar, wer die Tat im Ausland begangen hat, sich in der Schweiz befindet und nicht ausgeliefert wird, sofern die Tat auch am Begehungsort strafbar ist. Ist das Gesetz des Begehungsortes für den Täter das mildere, so ist dieses anzuwenden. Artikel 6 des Strafgesetzbuches ist anwendbar.
Art. 73 StPO. Geheimhaltungspflicht
1 Die Mitglieder von Strafbehörden, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die von Strafbehörden ernannten Sachverständigen bewahren Stillschweigen hinsichtlich Tatsachen, die ihnen in Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit zur Kenntnis gelangt sind.
2 Die Verfahrensleitung kann die Privatklägerschaft und andere Verfahrensbeteiligte und deren Rechtsbeistände unter Hinweis auf Artikel 292 StGB verpflichten, über das Verfahren und die davon betroffenen Personen Stillschweigen zu bewahren, wenn der Zweck des Verfahrens oder ein privates Interesse es erfordert. Die Verpflichtung ist zu befristen.
Art. 222 StGB. Fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst
1 Wer fahrlässig zum Schaden eines anderen oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.
2 Bringt der Täter fahrlässig Leib und Leben von Menschen in Gefahr, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
Art. 125 StGB. Fahrlässige Körperverletzung
1 Wer fahrlässig einen Menschen am Körper oder an der Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2 Ist die Schädigung schwer, so wird der Täter von Amtes wegen verfolgt.
Art. 49 StGB. Konkurrenz
1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2 Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3 Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
Art. 47 StGB. Strafzumessung. Grundsatz
1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2 Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
Art. 117 StGB. Fahrlässige Tötung
Wer fahrlässig den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
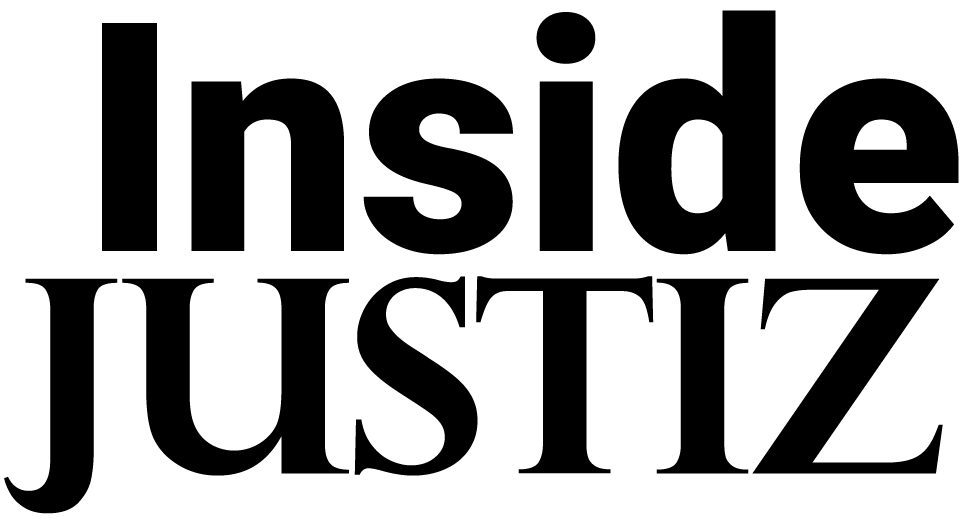
Nur so hat der Beschuldigte die Möglichkeit, seine Brufung ohne Risiko zurückzuziehen, was STA und Gericht sich sicher wünschen.