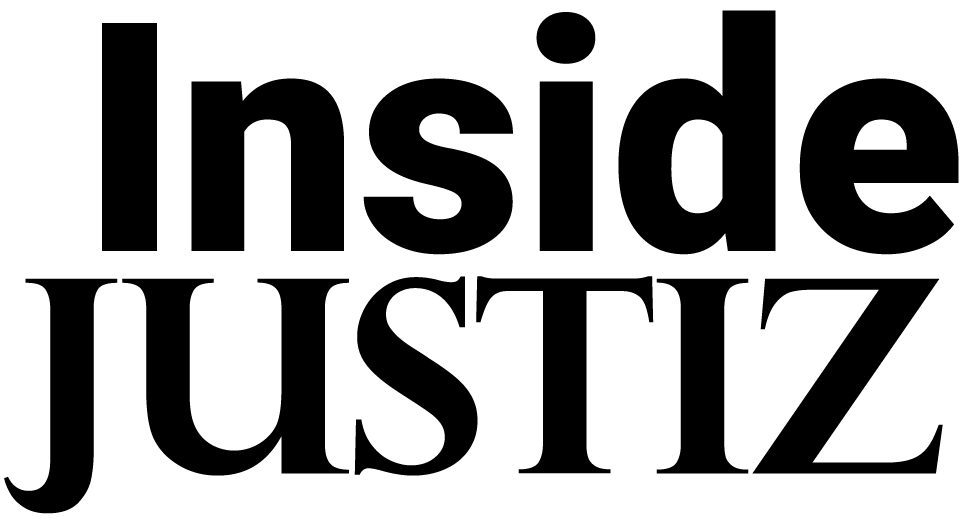Litigation-PR ist in grossen Verfahren längst Teil der Strategie – nur die Schweiz tut oft so, als spiele sich Justiz im luftleeren Raum ab. Während Staatsanwaltschaften offensiv kommunizieren und Schlagzeilen Biografien prägen, bleiben Beschuldigte und ihre Anwälte meist stumm. Im Gespräch mit Inside-Justiz erklärt Wirtschaftsrechtsprofessor und Prozesskommunikationspionier Patrick L. Krauskopf, warum der Hamburger Fall Block als Lehrstück gelungener Litigation-PR taugt, und weshalb Verteidiger, Banken und Behörden Verfahren endlich auch im medialen Raum führen müssen.
Inside-Justiz: Herr Krauskopf, die Litigation-PR-Thematik gewinnt weiter an Bedeutung, und der Hamburger Fall Block hätte mit seiner Dichte an Wendungen und Akteuren beinahe das Format eines Netflix-Stoffs. Zugleich zeigt er, dass Verfahren längst nicht mehr nur juristisch, sondern auch medial geführt werden. Ist das aus Ihrer Sicht ein Musterbeispiel für Litigation-PR?
Krauskopf: Aus fachlicher Sicht ist der bisherige Umgang mit der Öffentlichkeit tatsächlich ein Musterbeispiel gelungener Litigation-PR – mit der Einschränkung, dass wir immer nur eine Momentaufnahme beurteilen. Litigation-PR findet nicht nur im Gerichtssaal statt, sondern ebenso und bisweilen hauptsächlich im medialen Raum. Ziel ist dabei nicht einfach, die Öffentlichkeit im Sinne einer Partei zu „drehen“, sondern vor allem Reputation zu schützen und Vorverurteilungen vorzubeugen.
Woran machen Sie im Fall Block konkret fest, dass hier professionell gearbeitet wird?
Im Block-Verfahren verschiebt sich der Fokus sichtbar weg von vorschnellen Schuldzuweisungen hin zu einer differenzierten Wahrnehmung. Eingesetzt werden klassische Instrumente wie Interviews und Hintergrundgespräche, und das wirkt bisher klug orchestriert. Die Methodik ist dabei kein exotischer Sonderfall, sondern entspricht einem bewährten Muster: strukturierte Kernbotschaften, konsistente Sprecher, kontrollierte Taktung. Zur Ausnahme wird der Fall weniger durch die Technik als durch die enorme Medienpräsenz und die prominenten Beteiligten. Gerade deshalb kann er gleichzeitig eine Sonderstellung einnehmen und doch als Muster für gelungene Litigation-PR dienen – jedenfalls nach heutigem Stand.
Litigation-PR hat den Ruf, manipulativ zu sein. Ist sie in der heutigen Medienwelt eher Verteidigungs- oder Angriffsinstrument – und bedroht sie damit Rechtsfindung und Rechtsstaat?
Litigation-PR galt früher in zahlreichen Kreisen als gefährliches Manipulationsinstrument. Diese Sicht hat sich in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren deutlich gewandelt. Heute wäre es geradezu fahrlässig, die öffentliche Meinungsbildung der Gegenseite oder gar den Behörden zu überlassen. Der Manipulationsverdacht ist damit zwar nicht verschwunden, aber bei professioneller Anwendung bleibt er beherrschbar. Entscheidender Punkt sind klare Leitplanken: Litigation-PR darf nicht dazu führen, dass in der Öffentlichkeit eine „parallele Jurisdiktion“ entsteht, die den Rechtsstaat ersetzt. Sie soll ihn ergänzen – nicht aushöhlen.
Wie sieht verantwortungsvolle Litigation-PR in der Praxis konkret aus?
Verantwortungsvolle Litigation-PR verfolgt im Kern zwei Ziele: den Schutz der Reputation und die Prävention von Vorverurteilungen. Sie ersetzt emotionale Schnellschüsse durch eine nüchterne, klar gerahmte Kommunikation. Konkret heisst das: sorgfältige Auswahl und Gewichtung der Informationen, keine Übertreibungen, keine persönlichen Diffamierungen, klare Trennung von Fakten und Bewertung. Interviews, Stellungnahmen und Hintergrundgespräche werden gezielt eingesetzt – ohne das Publikum zu unterschätzen und ohne billige Zuspitzungen. Wer auf eine solche strukturierte Kommunikation verzichtet, überlässt die Deutungshoheit der Gegenseite. Verantwortungsvolle Litigation-PR fördert dagegen eine ausgewogene öffentliche Diskussion.
Lassen Sie uns auf die Schweiz schauen. Was zeigt der Fall Ignaz Walker aus Ihrer Sicht?
Der Fall Walker ist ein Klassiker dafür, wie Litigation-PR unterschätzt werden kann. Der Fall gilt als Beispiel für mediale Vorverurteilung und Justizkontroversen in der Schweiz, mit Kritik an der Uri-Justiz durch befangene Ermittler und dubiose Beweise. Bis heute halten sich einseitige Schlagzeilen und Stigmatisierungen. Viele zentrale Vorwürfe blieben in der öffentlichen Wahrnehmung praktisch unwidersprochen stehen. Das ist weniger ein Versagen der Justiz als ein Versagen der öffentlichen Kommunikation rund um das Verfahren. Professionelle Litigation-PR hätte hier dazu beitragen können, die Imageschäden abzufedern und die Einseitigkeit der Berichterstattung zu durchbrechen.
Der deutsche Strafverteidiger Christian Trentmann hat schon vor Jahren gesagt, Litigation-PR sei eine zeitgemässe Ergänzung der Beschuldigtenrechte. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ich teile diese Auffassung. Litigation-PR ergänzt die Verteidigungsrechte und unterstützt sie insbesondere dort, wo staatliche Behörden aktiv und offensiv in die Öffentlichkeit dringen. In Ermittlungs- und Strafverfahren nehmen Medienmitteilungen von Staatsanwaltschaften und Pressekonferenzen zu und prägen damit das öffentliche Narrativ. Litigation-PR ist eine Möglichkeit, diesem einseitigen Bild etwas entgegenzuhalten und den Beschuldigten vor einer medialen Vorverurteilung zu schützen. Im Fall Kachelmann hat man gesehen, dass eine professionelle Kommunikationsstrategie zumindest Teile des enormen öffentlichen Drucks korrigieren konnte. Allfällige Kritiker der Litigation-PR müssen dabei anerkennen, dass keine parallele Jurisdiktion im Mediensaal entstanden ist.
Staatsanwaltschaften treten in der Schweiz teils sehr proaktiv auf, während Betroffene und ihre Anwälte fast nicht kommunizieren. Warum bleiben die Beschuldigten so still – sind die Anwälte kommunikativ immer noch zu konservativ?
Ich bin seit über dreissig Jahren als Anwalt und mit Anwälten tätig, in der Schweiz und im Ausland. Der Unterschied zur Schweiz ist frappant. Wir haben hier nicht nur Berührungsängste gegenüber Medien – wir haben einfach keine Erfahrung. Weder an den Universitäten noch in der Anwaltsausbildung ist Medienkommunikation im Verfahren ein Thema. Es wird ignoriert. Bildlich gesprochen: Wenn sich Richter und Öffentlichkeit eine Meinung bilden, glauben viele Anwälte, diese Meinungsbildung werde ausschliesslich durch Rechtsschriften und Urteile geprägt. Wir verhalten uns, als wäre der Richter ein „Subsumtionsautomat“ ohne Werte, ohne Biografie. Man wirft den Sachverhalt hinein, und am Ende spuckt der Automat ein vermeintlich «richtiges» Urteil aus. Die Realität ist eine andere: Der rein juristische Austausch beeinflusst vielleicht 20 Prozent des richterlichen Ermessens. 80 Prozent haben mit juristischen Argumenten wenig zu tun, sondern mit subjektiver Werteordnung, Lebenserfahrung, Instinkt. Genau diesen Aspekt ignorieren wir in der Schweiz. Litigation-PR versucht, diese Faktoren zu erkennen und seriös zu adressieren.
Wo sehen Sie die spezifischen Schweizer Probleme – Ausbildung, politische Kultur, fehlende Professionalität?
Es ist eine Mischung. Erstens Ausbildung: Medien- und Krisenkommunikation in Verfahren kommen im Jurastudium faktisch nicht vor. Zweitens Kultur: Wir haben eine starke Tradition der Zurückhaltung, eine Neutralitätskultur, die leicht mit Schweigen verwechselt wird. Wer sich öffentlich verteidigt, gilt schnell als „unschön“. Drittens gibt es eine ganz praktische berufliche Komponente: In vielen Fällen fehlt es simpel an Professionalität. Es existieren weder klare Kommunikationskonzepte noch definierte Zuständigkeiten. Da wird dann im Ernstfall improvisiert – mit entsprechend bescheidenem Ergebnis. Medien wie Inside-Justiz haben in den letzten Jahren sicherlich dazu beigetragen, Richterinnen, Staatsanwälte und Verteidiger mit dieser Realität zu konfrontieren. Aber im System angekommen ist dieses Bewusstsein noch lange nicht.
Ein anderes Schweizer Beispiel ist der „nackte Anwalt“ aus der Ostschweiz: jahrelange Schlagzeilen, Freisprüche – und trotzdem bleibt ein Imageschaden. Sind das Lehrstücke für die Schweiz?
Absolut. Mediale Dauerberichterstattung brennt sich ein. Selbst wenn am Ende Freisprüche stehen, bleibt in der Öffentlichkeit „der nackte Anwalt“ hängen. Ohne strukturierte Gegenkommunikation kann man diesen Stempel kaum wieder lösen. Professionelle, frühzeitige Litigation-PR hätte hier dazu beitragen können, langfristige Imageschäden zumindest zu mindern. Mein Fazit ist klar: Die Schweiz muss Prozesskommunikation nicht nur „mitdenken“, sondern endlich ernsthaft angehen – als festen Bestandteil der Verteidigungsstrategie.
Aktuell diskutiert die Schweiz auch den UBS-Fall. International verteidigt sich die Bank, kommunikativ wirkt sie eher passiv. Hat UBS eine Chance verpasst, Vertrauen früh zu stabilisieren?
Wenn man sieht, was politisch rund um die UBS aktuell in Bundesbern passiert, ist offensichtlich, dass im Hintergrund kommuniziert wird. Aber gegen aussen blieb die Bank lange sehr zurückhaltend. Proaktive Kommunikation schafft Vertrauen – gerade bei systemrelevanten Instituten. Internationale Banken wie etwa die Deutsche Bank nutzen Litigation-PR in grossen Verfahren sehr aktiv, man denke an die Übernahme der Postbank. Mein Fazit: UBS hat hier noch Luft nach oben. Passivität in einem derart sensiblen Kontext schwächt Vertrauen – bei Kundschaft, Politik und Öffentlichkeit.
Sie haben die proaktive Rolle von Staatsanwaltschaften erwähnt. Entsteht hier nicht eine massive Waffenungleichheit?
Staatsanwaltschaften verfügen heute oft über gut ausgebaute Medienstellen und treten in heiklen Fällen teilweise offensiv auf. Rechtlich ist der Grundsatz der Waffengleichheit erst im Hauptverfahren voll wirksam. Im Vorverfahren legt die Strafprozessordnung den Schwerpunkt auf die materielle Wahrheit; eine formelle Waffengleichheit ist dort nach geltendem Recht nicht vorgesehen. Genau das führt aber in der öffentlichen Wahrnehmung zu einer Verzerrung: Das staatliche Narrativ dominiert, während die Betroffenen meist schweigen. Und obwohl dieses Ungleichgewicht kaum zu übersehen ist, verzichten Anwälte nach wie vor auf professionelle Prozesskommunikation. Das ist – gerade in medienintensiven Verfahren – aus meiner Sicht ein Kunstfehler.
Müssten Gerichte und Behörden ihre Kommunikationspraxis anpassen, um Fairness zu sichern?
Transparente, planvolle Kommunikation stärkt Fairness und Vertrauen in die Justiz. Internationale Beispiele zeigen das deutlich: Die US-Bundesgerichte verfügen etwa über professionelle Presseabteilungen, die Verfahren sachlich begleiten, ohne den Prozess zu politisieren. In der Schweiz gibt es einzelne positive Ansätze – etwa beim Bundesverwaltungsgericht, das seine Gerichtskommunikation reflektiert und schrittweise ausbaut. Aber strukturell fehlt vieles noch, wie wir im Fall „Carlos“ gesehen haben: Die fast fehlende Kommunikationsstrategie der Strafjustiz führte zu massiver Empörung und Unverständnis in der Öffentlichkeit. Daraus hätte man Lehren ziehen müssen. Mein Fazit: Wir brauchen neue Standards für Gerichtskommunikation –um Urteile verständlich und einordnungsfähig zu machen.
Wie beurteilen Sie die Rolle der Medien – gerade im Zeitalter von Social Media, wo Narrative kaum mehr kontrollierbar sind?
Heute verbreiten sich Narrative viral – manchmal verzerrt oder schlicht falsch. Einzelne Bilder, Ausschnitte von Plädoyers, zugespitzte Schlagzeilen werden auf TikTok, Instagram oder X millionenfach geteilt. Man sieht in internationalen Wahlkämpfen sehr deutlich, wie schnell sich dadurch Stimmungen verschieben können. Wenn Gerichte und Verteidigung in diesem Umfeld weiterhin nur mit klassischen Mitteln arbeiten, verlieren sie die Deutungshoheit. Das heisst nicht, dass sie selbst Influencer werden sollen. Aber sie müssen digitaler, schneller und erklärender kommunizieren – mit klaren, faktenbasierten Botschaften, die auch online funktionieren.
Sollte Litigation-PR in der Schweiz klareren Regeln unterstellt werden – etwa über das anwaltliche Berufsrecht oder durch Standards der Kommunikationsbranche?
Rechtliche Leitplanken gibt es im Kern bereits: Standesrecht der Anwälte, Persönlichkeitsschutz, Amtsgeheimnis, Unschuldsvermutung. Es besteht die Gefahr, dass mangels Erfahrungswerte eine Regulierung eher kontraproduktiv wäre. Sinnvoller ist aus meiner Sicht eine starke Selbstregulierung: klare berufsethische Standards für Litigation-PR – etwa in Form eines „Swiss Code of Litigation-PR“ –, an den sich spezialisierte Kanzleien und Kommunikationsberater binden. Das schafft Transparenz und Vertrauen, ohne die notwendige Flexibilität zu verlieren.
Wo sehen Sie die grössere Gefahr: dass Litigation-PR zum reinen Spin verkommt – oder dass sie weiterhin kaum genutzt wird?
In der Schweiz ist Litigation-PR immer noch relatives Neuland. Einzelne prominente Fälle – wie Walker – zeigen klar, welchen Schaden kommunikative Untätigkeit anrichten kann. Die grössere Gefahr ist deshalb derzeit nicht der zynische Spin, sondern die Leerstelle: dass Beschuldigte, Unternehmen und Institutionen weiterhin ohne professionelle Prozesskommunikation in hochkomplexe, mediale Verfahren hineingehen. Das führt regelmässig zu Verzerrungen der öffentlichen Meinung und zu Reputationsschäden.
Zum Schluss: Wenn Sie ein Leitbild für Litigation-PR in der Schweiz formulieren müssten – was wäre Ihr Kernsatz?
Litigation-PR darf keine Show sein. Sie ist eine notwendige, sachliche Ergänzung eines funktionierenden Rechtsstaats – im Dienst von Fairness, Transparenz und Reputation, nicht im Dienst der Schlagzeile.
Titelbild: Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf ist Professor für Wirtschafts- und Wettbewerbsrecht, IFL Institut für Finance und Law
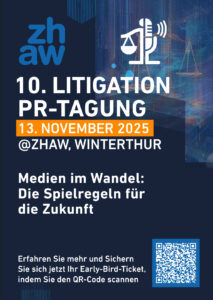
10. Litigation-PR-Tagung
in Winterthur
Die 10. Litigation-PR-Tagung am 13. November 2025 ist der Leuchtturm-Event für alle, die Verfahren nicht nur juristisch, sondern auch kommunikativ gewinnen wollen.
Am Donnerstag, 13. November 2025, verwandelt die ZHAW School of Management and Law in Winterthur ihre Aula in ein Labor für moderne Prozesskommunikation. Gastgeber Prof. Patrick L. Krauskopf, Stephan Rösli und Céline Scherrer setzen unter dem Leitmotiv «Medien im Wandel – die Spielregeln für die Zukunft» die Tonspur für die Branche: Wie setzt man Narrative rechtssicher? Wie reagiert man in Echtzeit auf Live-Ticker, Social Feeds und Schlagzeilen? Wie hält man die Leitplanken ein und bleibt trotzdem durchsetzungsstark?
An der Tagung treten führende Persönlichkeiten aus Politik, Medien, Wirtschaft und Wissenschaft auf – darunter Ständerätin Esther Friedli, bauenschweiz-Direktorin Cristina Schaffner sowie SonntagsZeitung-Chefredaktor Arthur Rutishauser. Es erwartet Sie ein vielfältiges Programm mit Vorträgen, Diskussionen und zahlreichen Austauschmöglichkeiten.
Auf der Bühne und im Saal treffen sich Namen, die Litigation-PR täglich prägen und herausfordern: Moritz Leuenberger bringt die Perspektive des politischen Krisenmanagements, Nik Gugger liefert Impulse aus der Bundespolitik, Armin Wolf (ORF) zeigt, wie man unter Druck präzise fragt und präzise antwortet, Florian Klenk (Falter) und Marcel Kohler (TX Group) öffnen die Redaktionssicht auf Tempo, Timing und Quellenlage, Monica Fahmy und Sven Millischer sprechen über Glaubwürdigkeit, Recherche und Verantwortung im medialen Gerichtssaal, Colin Porlezza (USI) ordnet die Plattform- und Algorithmenlogik ein, Cristina Schaffner (bauenschweiz) bringt die Verbands- und Allianzenperspektive.
Die Reihe hat Tradition und Strahlkraft: In früheren Ausgaben gaben Alt-Bundesrat Adolf Ogi und Alt-Bundesrat Kaspar Villiger am Abend ihre Einordnung – ein Brückenschlag zwischen politischer Entscheidungskultur und öffentlicher Kommunikation, der Litigation-PR heute massgeblich prägt.
Die Jubiläumsausgabe denkt Litigation-PR als Praxis: Fallanalysen mit echten Cases, Live-Analyse von Medienstatements, Werkstattgespräche zu Sprechrollen, Kernbotschaften und Fact-Checking in Echtzeit, Simulationen zu «Do/Don’t» bei heiklen Verfahrenssituationen – vom Umgang mit Leaks bis zur Frage, wann man schweigt und wann man setzt.
Wer aus Kanzlei, Justiz, Unternehmen, Verband oder Redaktion kommt, profitiert doppelt: juristisch belastbare Standards, die im Saal bestehen, und kommunikative Strategien, die draussen tragen. Dazu kommt das Netzwerk: Entscheiderinnen und Entscheider aus Recht, Medien, Politik und Kommunikation auf engem Raum, kurze Wege zu Redaktionen, schnelle Feedbackschleifen zu Argumentationslinien, Kontakte zu spezialisierten Litigation-PR-Teams.
Wer Litigation-PR nicht nur verstehen, sondern anwenden will, gehört in die Aula der ZHAW. Programm, Anmeldung, Networking – alles an einem Ort.
https://litigation-pr.ch/