In Glarus gibt es Gnade nur auf dem Papier. Im Fall des Treuhänders aus den Jahren 2004 bis 2006 ist das Ermessen äusserst eingeschränkt. Der Fall ist alt, die Haft ist neu – und doch wirkt alles aus der Zeit gefallen. Trotz eines Zeitabstands von fast zwei Jahrzehnten lehnt Glarus den gezielten Teilerlass ab, diskutiert einen orchestriert wirkenden Kommissionsbericht kaum öffentlich und lässt zentrale Fragen bei der Strafanstalt Saxerriet offen. Am 1. Oktober muss der Treuhänder hinter Gitter. Am Ende wird also Vollzug um des Vollzugs willen betrieben – und genau das untergräbt das Vertrauen in die Schweizer Justiz. Dies ist der zweite Teil unserer Geschichte aus Glarus.
Ein Treuhänder soll für (angebliche) Taten aus den Jahren 2004 bis 2006 noch für 18 Monate ins Gefängnis. Das erstinstanzliche Urteil fiel 2019, das Obergericht Glarus bestätigte den Schuldspruch am 24. Juni 2022 – reduzierte aber die Strafe auf 36 Monate, davon 18 Monate unbedingt. Das Bundesgericht wies die Beschwerde im Februar 2025 ab. Strafantritt ist der 1. Oktober 09.00 Uhr 2025 in der Strafanstalt Saxerriet im St. Galler Rheintal. (Der erste Artikel Absurder Glarner Justiz-Zirkus finden Sie hier.)
Parallel bat der Verurteilte den Kanton Glarus um Gnade: sechs Monate Teilerlass, damit der unbedingte Rest unter die Schwelle für Halbgefangenschaft oder Electronic Monitoring fällt. Der Landrat lehnte dieses Gesuch Ende August 2025 diskussionslos ab. Der Kern der Geschichte bleibt: Zwischen Tat und Vollzug liegen rund zwei Jahrzehnte – eine Distanz, die jedes rechtsstaatliche Verfahren auf seine Reife prüft. Diese Chronologie ist nicht nur eine Aneinanderreihung von Daten. Sie erzählt eine Geschichte von verpasster Beschleunigung, von juristischer Routine, die zu lange dauerte, und von politischen Entscheidungsträgern, die am Ende zwar formal korrekt handelten, aber in der Sache den Blick verengten. Wer die Regeln des Rechts bejaht, muss hier aus Prinzip unruhig werden.
Das „Gutachten“ der Rechtskommission: eng im Geist
Der Landrat des Kantons Glarus stützte seinen Entscheid auf den Bericht seiner Rechtskommission zum Begnadigungsgesuch. Formal ist das sauber: Die Kommission prüft, empfiehlt, der Rat beschliesst. Inhaltlich wirkt der Bericht jedoch wie eine zweite Urteilsbegründung – nicht wie eine offene Gnadenabwägung. Anstatt das politische Ermessen an den Kriterien Billigkeit, atypische Härte und Resozialisierung zu entfalten, wiederholt der Bericht vor allem Wertungen aus den Gerichtsurteilen („Schwere der Tat“, „fehlende Einsicht“) und setzt damit den Rahmen so eng, dass Gnade kaum noch denkbar ist.
Besonders irritiert die optische Verschiebung des Zeitproblems: Der Bericht betont, zwischen Bundesgerichtsentscheid und Vollzug liege keine „lange Zeit“. Das mag stimmen – nur ist es die falsche Bezugsgrösse. Entscheidendes Kriterium ist die Zeitspanne zwischen Tat und Vollzug. Fast 20 Jahre sind in einem Rechtsstaat keine Nebensache, sondern eine Frage der Fairness: Was will Vollzug nach zwei Jahrzehnten noch erreichen? Abschreckung? Generalprävention? Resozialisierung? Wer Gnade willkürlich auf die Moral des Täters verengt, lässt diese verfassungsnahen Fragen unbeantwortet.
Auch das eigentliche Ziel des Gesuchs wird kleingeredet. Gefordert war kein „Ausstieg aus der Strafe“, sondern ein gezielter Teilerlass, damit eine rechtskonforme, resozialisierungsorientierte Vollzugsform (Halbgefangenschaft/EM) überhaupt zulässig wird. Dieses Anliegen ist pragmatisch, nicht dreist. Es akzeptiert die Strafe, aber verlangt nach einer Form, die Arbeit, Familie und Wiedereingliederung nicht künstlich zerstört. Dass die Kommission genau diese Brücke nicht ernsthaft prüft, ist ein politischer Entscheid – aber kein starker.
Schliesslich der Prozess: Der Landrat entschied in geheimer Abstimmung und ohne offene Plenardebatte. Das Resultat: 57:0. Das ist zulässig. Demokratietheoretisch kratzt es dennoch: Gerade atypische Fälle brauchen öffentliches Licht, damit die Öffentlichkeit versteht, warum Gnade gewährt oder versagt wird. Wer Gnade hinter verschlossenen Türen verwaltet, ruiniert ihr Ansehen.
Saxerriet antwortet – und schweigt an den entscheidenden Stellen
Wir haben der Strafanstalt Saxerriet einen Katalog konkreter Fragen geschickt. Gekommen sind ausführliche, aber nicht wirklich erhellende Antworten. Ja, die Anstalt ist gut ausgelastet; ja, Resozialisierung ist Leitlinie; ja, mit Halbgefangenschaft hat man gute Erfahrungen; und ja, Electronic Monitoring entscheidet nicht die Anstalt, sondern die Einweisungsbehörde. Das ist sachlich richtig – aber erwartbar generisch.
Dort, wo es um die Besonderheiten dieses Falls ginge, bleibt es dünn.
- Wie sieht eine individualisierte Vollzugsplanung für einen Mann im fortgeschrittenen Erwerbsalter aus, der beruflich und sozial integriert ist?
- Welche Arbeitsinhalte bietet der offene Vollzug Menschen mit akademisch-kaufmännischem Profil, die nicht in eine werkstattzentrierte Routine passen?
- Wie digital darf Resozialisierung im Jahr 2025 sein, wenn Handy- und Internetregeln aus Sicherheitsgründen eng sind – und wie können gleichzeitig realistische Arbeitswelten abgebildet werden?
Auch die Frage, welche Verbesserungen Saxerriet selber gerne hätte, bleibt im Nebel. Das ist keine Böswilligkeit – es klingt nach System: Man arbeitet korrekt, aber auf Sicht. Wer den Fall auf sich wirken lässt, merkt: Genau diese „Korrektheit auf Sicht“ führt dazu, dass besondere Lebenslagen in Standardpfaden verschwinden.
Was Glarus in der Sache überzeugend hätte leisten müssen
Es wäre die Aufgabe der Rechtskommission gewesen, das Ermessen voll auszuschöpfen – nicht, es zu verengen. Dazu gehört eine ehrliche Auseinandersetzung mit vier Punkten:
- Erstens, der Zeitfaktor. Zwei Jahrzehnte sind nicht nur „lange her“, sie verändern Lebensläufe. Resozialisierung nach so langer Zeit wirkt anders als nach zwei oder fünf Jahren. Wer Gnade verweigert, muss erklären, warum trotz dieser Zeitdistanz ein härterer Vollzug angemessen ist.
- Zweitens, die Ziellogik des Vollzugs. Halbgefangenschaft und EM sind keine Geschenke, sondern rechtsstaatlich vorgesehene Instrumente, um Strafen in die Gegenwart der Betroffenen einzupassen – mit Arbeit, Familie, Verantwortung. Wenn ein minimaler Teilerlass die Tür zu diesen Instrumenten öffnet, ist das kein „Trick“, sondern ein Test für den Willen zur Resozialisierung.
- Drittens, die Transparenz. Wenn ein Kommissionsbericht inhaltlich die Weichen stellt, müssen seine Quellen, Alternativen und Abwägungen nachvollziehbar sein. Eine geordnete Aktenlage, inklusive der fristbezogenen Besonderheiten des Verfahrens, ist kein Luxus, sondern Grundlage politischer Verantwortung.
- Viertens, die Kohärenz im System. Wer in Urteilen eine Verletzung des Beschleunigungsgebots feststellt, kann beim Gnadenermessen nicht so tun, als gäbe es diesen Elefanten im Raum nicht. Die Gnadeninstanz ist das Korrektiv im Recht – nicht dagegen.
Und die unbeantworteten Fragen bleiben
Der Kanton Glarus verweist auf die Zuständigkeiten und die korrekte Form. Saxerriet beschreibt den Rahmen, wie er heute ist. Beides ist verständlich – aber es reicht nicht. Offene Punkte, die weitergeklärt werden müssen:
- Warum wurde der Zeitablauf nicht als eigenständiger, schwerer Billigkeitsgrund gewertet?
- Welche Schwelle für Halbgefangenschaft/EM hätte mit einem Teilerlass konkret erreicht werden können – und warum war das politisch nicht erwägbar?
- Wie sieht eine Vollzugsplanung aus, die nicht nur „Handwerk für alle“ vorsieht, sondern die Berufsrealität eines integrierten, älteren Ersttäters abbildet?
- Wer verantwortet das Zusammenspiel von Beschleunigungsverletzung, langem Beratungsstillstand und dem späten Vollzug – und welche Lessons Learned zieht der Kanton daraus für künftige Verfahren?
Dass diese Fragen bis heute nicht sauber beantwortet sind, ist kein Betriebsunfall, sondern Ausdruck einer Kultur: Man berät unter Ausschluss der Öffentlichkeit, lässt das Recht formal walten – und hofft, dass es damit sein Bewenden hat. In einem kleinen Kanton mag das funktionieren. Rechtsstaatlich ist es zu wenig.
Gnadenakt
Gnade ist kein Gnadenakt „gegen“ das Recht, sondern das rechtsstaatliche Ventil für atypische Fälle. Wer sie zur moralischen Absolution oder zur symbolischen Härteprobe verkürzt, missversteht ihren Sinn. Im Fall Glarus hätte eine transparente, offen begründete Verweigerung der Gnade möglich sein können. Stattdessen erhielt die Öffentlichkeit ein enges Kommissionspapier, eine stille Abstimmung und Antworten aus dem Vollzug, die den Sonderfall in Standards auflösen. So wirkt ein System, das formal korrekt ist – und materiell wenig überzeugend.
Learnings
Der Kanton sollte den Kommissionsbericht samt Quellenlage, Alternativen und Minderheitsnotizen offenlegen. Eine externe Evaluation der Gnadenpraxis – mit Blick in andere Kantone – würde helfen, die Kriterien zu schärfen. Saxerriet und die Einweisungsbehörde sollten darlegen, wie sie integrierte, ältere Ersttäter vollzugspraktisch führen wollen: mehr Halbgefangenschaft, Electronic Monitoring als Regel statt Ausnahme, arbeitsweltliche Brücken statt werkstattzentrierter Schablonen. Und der Landrat sollte für atypische Fälle die offene Debatte zum Standard machen. Demokratie braucht in sensiblen Fällen kein Flüstern, sondern Licht.
Wer diesen Fall als „Einzelfall“ abtut, verkennt sein Echo. Er ist ein Stresstest für unser Verständnis von Fairness und Funktionalität. Wenn wir nach 20 Jahren Vollzug um des Vollzugs willen betreiben, verlieren wir ausgerechnet das aus dem Blick, woran das Strafrecht am Ende gemessen wird: Gerechtigkeit im Hier und Jetzt.
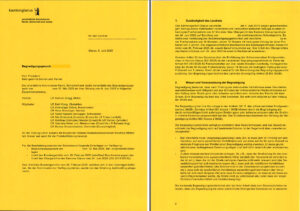
Eng im Geist
Unsere Analyse des Kommissionsberichts der Rechtskommission zum Begnadigungsgesuch mit Blick auf Neutralität, rechtliche Sorgfalt und argumentative Qualität.
1. Formale Neutralität
- Positiv:
- Zusammensetzung der Kommission wird transparent aufgeführt.
- Rechtsgrundlagen (Art. 381–383 StGB, Art. 22/25 EG StGB GL) sind korrekt zitiert.
- Mandat des Landrats als Begnadigungsbehörde wird sauber erläutert.
- Negativ:
- Keine Hinweise auf mögliche Ausstände oder Interessenkonflikte einzelner Mitglieder.
- Keine dokumentierten Minderheitsvoten; das Gutachten ist einstimmig, was keine Bandbreite der Meinungen erkennen lässt.
- Inhaltliche Neutralität
- Einseitige Gewichtung:
Die Kommission stützt sich fast ausschliesslich auf die strafrechtlichen Feststellungen der Vorinstanzen und deren Wertungen (z. B. „grosse kriminelle Energie“, „fehlende Reue“), ohne eine eigenständige Würdigung aktueller Entwicklungen vorzunehmen. - Gegenargumente untergewichtet:
Aspekte wie berufliche und soziale Integration, die der Gesuchsteller detailliert dargelegt hat, werden als „ungenügend“ oder „nicht belegt“ abgetan, ohne zu prüfen, ob diese Nachweise tatsächlich vorliegen könnten. - Fehlende Aktualität:
Es gibt keine Bezugnahme auf aktuelle Prognosen oder externe Vollzugsberichte, obwohl 19 bis 21 Jahre seit den Taten vergangen sind und das Obergericht eine günstige Legalprognose aussprach.
- Sprache und Ton
- Wertende Formulierungen:
Diese Begriffe stammen direkt aus dem Strafurteil, werden unkritisch übernommen und in einem Kontext wiederholt, in dem es um eine Billigkeitsentscheidung – nicht um Schuldfragen – gehen sollte.
- „tragende Rolle im Betrugskonstrukt“
- „massiver Verstoss gegen die Rechtsordnung“
- „grosse kriminelle Energie“
- Mangel an Distanz:
Das Gutachten wirkt wie eine zweite Urteilsbegründung, nicht wie eine neutrale Abwägung im Rahmen des Gnadenermessens.
4. Juristische Sorgfalt
- Begnadigungswürdigkeit:
Die Kommission verneint diese pauschal, indem sie fehlende Reue und mangelnde persönliche Angaben als Begründung heranzieht. Die gesetzliche Funktion des Gnadenerlasses – Billigkeit und besondere Härten – wird dadurch stark verengt. - Härtefallprüfung:
Zwar wird formal auf „ausserordentliche Härte“ eingegangen, die Argumentation bleibt aber schematisch („Vollzug ist immer belastend“) und ignoriert den langen Zeitablauf und die drohende berufliche und existenzielle Vernichtung, die der Antrag detailliert darlegt.
- Bewertung der Neutralität
|
Kriterium |
Bewertung (0–2) |
Kommentar |
|
Rechtsgrundlagen & Mandat |
2 |
korrekt zitiert |
|
Transparenz Zusammensetzung |
1 |
Ausstände nicht geprüft |
|
Vollständige Aktenbasis |
1 |
keine aktuellen Prognosen berücksichtigt |
|
Gehör/Parteivorbringen |
1 |
Argumente des Gesuchstellers kaum gewürdigt |
|
Pro-/Contra-Symmetrie |
0 |
einseitige Gewichtung |
|
Begründungstiefe |
1 |
viel Text, aber wenig eigene Analyse |
|
Aktualität der Prognose |
0 |
keine Berücksichtigung |
|
Tonalität |
0 |
wertend, moralisierend |
|
Minderheitsvoten dokumentiert |
0 |
keine abweichende Meinung erkennbar |
|
|
6/18 (≈33 %) |
stark eingeschränkte Neutralität |
- Kernaussagen
- Das Gutachten erfüllt formale Mindestanforderungen, ist aber inhaltlich stark einseitig.
- Es übernimmt Wertungen aus den Urteilen, anstatt das Ermessensspektrum des Landrats selbstständig zu prüfen.
- Wichtige Argumente des Gesuchstellers (lange Zeitspanne, Integration, günstige Prognose) werden nicht ernsthaft geprüft.
- Der Landrat konnte so nur über ein unausgewogenes Bild entscheiden.
- Empfehlungen für die Berichterstattung
- Investigativer Ansatz: Thematisiere, dass die Kommission ihre Rolle als neutrale Prüfinstanz nicht wahrgenommen hat.
- Zitate nutzen: Etwa „Begnadigung soll die Strenge des Gesetzes nur in Ausnahmefällen lockern“ – um zu zeigen, dass diese Ausnahme hier nie ernsthaft geprüft wurde.
- Kontext liefern: Vergleich mit anderen Kantonen zeigt, dass in ähnlich gelagerten Fällen neutralere Abwägungen getroffen werden.

«Begnadigungsgesuche sind selten und sehr individuells»
Unsere Fragen wurden von Michael Schüepp Ratssekretär und stellvertretender Ratsschreiber des Kantons Glarus beantwortet. Er leitet das Sekretariat des Glarner Landrates (Kantonsparlament) und ist dort masgeblich an der Organisation, Dokumentation sowie der Koordination von Parlamentsgeschäften beteiligt.
Auf welcher gesetzlichen Grundlage (Kantonsverfassung, EG StGB) hat die Kommission das Gutachten erstellt? Die Zuständigkeit des Landrates ergibt sich aus Artikel 91 Absatz 1 Buchstabe h der Kantonsverfassung in Verbindung mit Artikel 22 Absatz 1 EG StPO. Die Behandlung des Gesuchs richtet sich nach Artikel 112 der Landratsverordnung. Die Zuständigkeit der Kommission Recht, Sicherheit und Justiz für die Vorberatung von Begnadigungsgesuchen zuhanden des Plenums ist in Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe f der Landratsverordnung festgehalten. Zu berücksichtigen ist, dass es sich bei einer Begnadigung um einen in diesem Sinne politischen Entscheid handelt. Dieser belässt Ermessensspielraum. Begnadigung bedeutet, dass nach Prüfung der individuellen Verhältnisse eines Verurteilten ausnahmsweise nach Billigkeit und aus Gründen der mitmenschlichen Rücksichtnahme auf den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise verzichtet wird. Anstelle des Rechts tritt dann Gnade. Es gibt keinen Anspruch auf eine Begnadigung. Auch ist es nicht Aufgabe der Begnadigungsbehörde, den Fall juristisch aufzuarbeiten bzw. die Schuld des Gesuchstellers zu beurteilen.
Wurden Kriterien definiert, nach denen die Begnadigungswürdigkeit geprüft wurde? Wenn ja, welche? Die Begnadigung hat ihre Grundlage in den Artikeln 381 ff. des Schweizerischen Strafgesetzbuches. Das Gesetz beschränkt die Begnadigung nicht auf bestimmte Gründe. In der Regel wird aber zweierlei vorausgesetzt:
Der Verurteilte muss «begnadigungswürdig» sein, d. h. er muss sich im Hinblick auf sein Vorleben, auf seine persönlichen Verhältnisse und vor allem auf die für seine Zukunft zu stellende Prognose der Wohltat einer Begnadigung würdig erweisen. Er muss grundsätzlich eine rechtsgetreue Gesinnung zeigen und darf nicht liederlich oder arbeitsscheu sein.
Zudem müssen weitere Umstände vorliegen: etwa, dass der Strafvollzug eine ausserordentliche Härte darstellt, dass die mit der Strafe verfolgten Zwecke nicht mehr relevant sind, dass sich die rechtlichen oder tatsächlichen Verhältnisse wesentlich geändert haben oder ein langer Zeitablauf zwischen Urteil und Vollstreckung besteht.
Welche Weisungen oder Checklisten wurden bei der Beurteilung angewendet?
Siehe Antwort auf ihre vorherige Frage.
Gab es in der Rechtskommission Ausstände oder potenzielle Interessenkonflikte einzelner Mitglieder? Nein.
Wurde die Zusammensetzung der Kommission und deren Unabhängigkeit für diesen Entscheid extern geprüft? Nein.
Wie wird sichergestellt, dass die Kommission nicht einseitig die Wertungen der Urteile übernimmt, sondern eigenständig prüft? Der Kommission liegen jeweils nicht nur Urteile vor, sondern auch das Gesuch eines Gesuchstellers. Darin hat ein Gesuchsteller umfassende Möglichkeiten, seine Sicht der Dinge darzulegen und mit Nachweisen zu untermauern.
Auf welche Dokumente stützte sich das Gutachten konkret wie Urteile, Vollzugsberichte, Prognosen und Stellungnahmen? Zum konkreten Inhalt des Kommissionsberichtes, der aufgrund des Persönlichkeitsschutzes nicht öffentlich publiziert wurde, nehmen wir keine Stellung. Grundsätzlich stützt sich die Kommission auf das Gesuch und zieht bei Bedarf weitere Akten bei, zum Beispiel Urteile.
Wurden aktuelle Prognosegutachten oder Vollzugsberichte beigezogen? Wenn nein, weshalb nicht? Auch hierzu nehmen wir aufgrund des Persönlichkeitsschutzes keine Stellung. Die Kommission zieht grundsätzlich jene Dokumente und Informationen bei, die sie für die Beurteilung des Gesuchs als notwendig erachtet. Dazu gehören selbstverständlich auch die Beilagen, welche mit einem Gesuch eingereicht werden.
Wurde die Zeitspanne seit der Tat bei der Prüfung der Resozialisierung berücksichtigt? Siehe Antwort auf ihre vorherige Frage. Der konkrete Bericht ist nicht öffentlich zugänglich.
Wie konnte der Gesuchsteller seine Argumente und Nachweise einbringen? Gesuchsteller führen ihre Argumente im Gesuch selbst aus, mit welchem sie ihren Antrag begründen. Zusätzlich können sie weitere Unterlagen einreichen, welche der Begründung des Antrages dienen.
Wurde geprüft, ob die vom Gesuchsteller eingereichten Unterlagen vollständig berücksichtigt wurden? Der Landrat entscheidet auf Basis des Kommissionsberichtes. Diesem werden die vom Gesuchsteller eingereichten Unterlagen beigelegt. Das Landratsplenum ist somit in der Lage, sich ein Bild darüber zu machen, welche Abwägungen die Kommission vorgenommen hat. Letztlich liegt es im Interesse des Gesuchstellers, sein Gesuch überzeugend zu begründen und zu dokumentieren.
Wie wird sichergestellt, dass Pro- und Contra-Argumente gleichwertig in die Abwägung einfliessen? Es ist Kernaufgabe einer Kommission, Pro- und Kontra-Argumente sorgfältig abzuwägen.
Warum werden im Gutachten mehrfach wertende Begriffe wie «grosse kriminelle Energie» verwendet, die aus den alten Urteilen stammen? Zum konkreten Inhalt des Kommissionsberichtes nehmen wir aufgrund des Persönlichkeitsschutzes keine Stellung.
Weshalb enthält das Gutachten keine eigenständige Beurteilung der aktuellen Situation? Auch hierzu nehmen wir mit Verweis auf den Persönlichkeitsschutz keine Stellung.
Gab es innerhalb der Kommission abweichende Meinungen oder Minderheitsvoten? Wenn ja, warum sind diese nicht dokumentiert? Es gilt das Kommissionsgeheimnis. Grundsätzlich sind wesentliche Minderheiten in einem Kommissionsbericht gemäss Artikel 34 Absatz 1 der Landratsverordnung auszuweisen. Enthält ein Bericht keine solchen Minderheitspositionen, ist davon auszugehen, dass es sie nicht gab.
Gibt es im Kanton Glarus eine Praxisübersicht zu Begnadigungsentscheiden? Es gibt keine Praxisübersicht im eigentlichen Sinne. Begnadigungsgesuche sind selten und sehr individuell. Der Landrat stimmt Begnadigungsgesuchen nur äusserst zurückhaltend zu.
Wurden bei der Beurteilung vergleichbare Fälle berücksichtigt? Die Fallzahlen sind sehr gering (drei Fälle in den vergangenen fünfzehn Jahren). Die Situation der Gesuchsteller ist jeweils sehr individuell. Eigentlich vergleichbare Fälle gibt es nicht. Die Kommission legt jedoch Wert darauf, dass die Kriterien und Umstände gleichmässig gehandhabt werden.
Wie stellt der Landrat sicher, dass die Rechtsgleichheit bei Begnadigungen gewährleistet ist? Vorab ist festzuhalten, dass das Prinzip der Rechtsgleichheit im Kontext des speziellen – politischen – Charakters von Begnadigungen gesehen werden muss. Die bisherigen Entscheide des Landrates zeigen, dass ein gleichbleibender Massstab unter Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten angewendet wurde. Eine willkürliche Behandlung eines Gesuchs fand nicht statt.

«Die Strafanstalt Saxerriet hat ein sehr breites und strukturiertes Beschäftigungsangebot.»
Das Amt für Justizvollzug des Kantons St. Gallen wird ab 1. Februar 2025 durch Barbara Looser Kägi geführt. Die 53-jährige Looser Kägi löst die bisherige Leiterin Barbara Reifler ab, die seit 1. Dezember 2024 neue Kommandantin der Kantonspolizei St. Gallen ist. Barbara Looser Kägi ist insgesamt rund 21 Jahre für das Sicherheits- und Justizdepartement tätig und blickt als Juristin mit Anwaltspatent sowie als MAs in Kriminologie auf einen reichhaltigen Werdegang zurück. Ab 2001 war sie als Untersuchungsrichterin bei der Staatsanwaltschaft St. Gallen beschäftigt. Anschliessend war sie zehn Jahre als Jugendanwältin tätig, rund vier Jahre davon als Gruppenleiterin in einer Führungsfunktion. Im August 2018 übernahm Barbara Looser Kägi die Leitung des Amtes für Justizvollzug und wechselte im Mai 2021 als Leiterin der Strafanstalt Saxerriet und Stellvertretende Leiterin Amt für Justizvollzug in ihre heutige Funktion.
Frau Looser Kägi, wie ist die aktuelle Auslastung der Strafanstalt Saxerriet?
Aktuell sind 91 Prozent der Zellen belegt.
Stellt eine hohe Belegung die Anstalt vor besondere Schwierigkeiten, zum Beispiel beim Personalschlüssel, bei der Sicherheit oder der Betreuung?
Eine hohe Ausnützung aller Dienste fordert das Personal stark.
Im Strafvollzug treffen ganz unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander – von wenig Qualifizierten bis hin zu hochqualifizierten Berufsleuten. Welche besonderen Herausforderungen ergeben sich daraus?
Es gibt in unserer Anstalt keine besonderen Programme für Inhaftierte mit akademischem Hintergrund. In den verschiedenen Werkbetrieben stehen einfache und anspruchsvolle Tätigkeiten mit hohem Bezug zur freien Wirtschaft zur Verfügung. Die Beschäftigung von Inhaftierten mit höheren Qualifikationen ist etabliert und bewährt.
Sehen Sie besondere Probleme, wenn Menschen unterschiedlicher Herkunft, Ausbildung und Lebenswelt im Vollzug aufeinandertreffen?
Das ist seit jeher Vollzugsalltag und Teil der täglichen Herausforderung aller beteiligten Institutionen und Dienste. Gleichzeitig sind diese Themen gute soziale Lernfelder bei vielen Inhaftierten.
Häftlinge sind in der Anstalt zur Arbeit verpflichtet (Art. 81 StGB). Inwiefern kann die Strafanstalt auf individuelle Fähigkeiten eingehen?
Die Strafanstalt Saxerriet hat ein sehr breites und gut strukturiertes Beschäftigungsangebot. Dank dieser Vielfalt kann gut auf die individuellen Fähigkeiten eingegangen werden. Herausforderungen sind eher die teils grossen Defizite oder das gänzliche Fehlen einer Anbindung an den Arbeitsmarkt.
Welche Möglichkeiten gibt es im offenen Vollzug, beruflich und sozial integrierte Personen teilweise in der Arbeit zu halten?
Beschäftigung in den Anstaltsbetrieben, individuelle Bildungsmassnahmen, Entlassungsvorbereitungen und ein Freizeitangebot.
Welche Erfahrungen hat die Strafanstalt mit Vollzugslockerungen gemacht? Welche Kriterien gelten – und wie hoch schätzen Sie die Missbrauchsgefahr ein?
Vollzugslockerungen sind fester Bestandteil des Gestaltungsprinzips im offenen Vollzug und wichtige Lern- und Übungsumfelder, insbesondere im Hinblick auf die Wiederintegration. Die Missbrauchsgefahr ist nicht gänzlich auszuschliessen, aber gemäss unserer Erfahrung sehr tief. Die Inhaftierten sollen lernen, sich selbstverantwortlich und straffrei innerhalb der gesellschaftlichen Normen und Gesetzen zu verhalten. Zum Lernprozess gehören auch Versagen und Rückschläge dazu.
Electronic Monitoring ist in der Schweiz nur bis 12 Monate möglich. Würden Sie eine Ausweitung – zum Beispiel wie in Österreich auf 24 Monate – begrüssen?
Wir halten uns bei der Anordnung von Electronic Monitoring an die geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
Wie beurteilen Sie den Mix von geschlossenem, offenem Vollzug und Electronic Monitoring in Bezug auf Resozialisierung?
Sinnvoll und zielführend.
Wie bereitet sich die Anstalt auf die Aufnahme eines neuen Häftlings vor? Welche Abklärungen (psychologisch, medizinisch, sozial) werden dabei vorgenommen?
Die Anmeldeunterlagen werden gesichtet und an die zuständigen Fachstellen weitergeleitet. Je nach Ausgangslage erfolgen Rücksprachen bei einweisenden Behörden, Fachdiensten und weiteren Personen. Absprachen und organisatorische Massnahmen erfolgen individuell.
Welche Entwicklungen beobachten Sie im Verhalten der Insassen in den letzten Jahren – zum Beispiel mehr psychische Probleme, mehr Gewalt oder mehr Abhängigkeiten?
Eine Zunahme von psychischen Auffälligkeiten und sozialen Defiziten bei gleichzeitiger Abnahme der Absprachefähigkeit. Abhängigkeiten sind seit vielen Jahren konstant, mit Zunahmen von Langzeitkonsumenten inkl. THC mit gesundheitlichen Begleiterscheinungen.
Wie werden Mitarbeitende im Umgang mit schwierigen Situationen – etwa Gewalt, Manipulationsversuchen oder psychischen Krisen – geschult?
–
Welche internen Verhaltensregeln gelten für das Personal im Kontakt mit den Häftlingen?
Die Strafanstalt hat einen Verhaltenskodex und berufsethische Regeln für die Zusammenarbeit mit Eingewiesenen definiert. Das Dokument ist zu umfangreich für eine kurze Beschreibung.
Wird der Strafvollzug in der Schweiz eher als Repression oder als Resozialisierung verstanden – und wie positioniert sich die Strafanstalt Saxerriet in diesem Spannungsfeld?
Die Strafanstalt Saxerriet ist eine offene Strafanstalt, die auf das Ziel der Resozialisierung hinarbeitet.
Welche Massnahmen haben sich bei Ihnen als besonders wirksam für die Rückfallprävention erwiesen?
Wir gehen davon aus, dass die im Strafvollzug angewendeten Massnahmen in ihrer Gesamtheit wirksam sind.
Welche Rolle spielt Digitalisierung im Vollzug – zum Beispiel beim Lernen oder bei der Kommunikation?
Die Digitalisierung gewinnt auch im Strafvollzug an Bedeutung. Wir versuchen, die Eingewiesenen im Rahmen der Möglichkeiten auch diesbezüglich zu fördern. Angesichts der bestehenden Einschränkungen (Verbot der Benutzung von Mobiltelefonen und Verbot des Internetzugriffs) ist dies jedoch nur eingeschränkt möglich.
Wie pflegt die Anstalt die Kooperation mit Angehörigen, Arbeitgebern und Fachstellen im Hinblick auf eine gelingende Wiedereingliederung?
Vollzugsarbeit ist zielorientierte Teamarbeit. Dazu gehören auch Fachdienste, einweisende Behörden, externe Dienstleister und Angehörige. Arbeitgeber sind unerlässlich für die Sicherstellung von Beschäftigungsfeldern in der Anstalt und als Partner für die Wiederintegration in die Arbeitswelt.
Welche Wünsche und Erwartungen haben Sie ganz allgemein an einen modernen Strafvollzug in der Schweiz?
(ohne Antwort)
Unter welchen Bedingungen werden Insassen mit elektronischen Fussfesseln ausgestattet? Wer entscheidet über diese Massnahme – die Anstalt oder der zuweisende Kanton?
Die Einweisungsbehörde entscheidet über die Bewilligung von Electronic Monitoring wie Front Door und Back Door.
Welche Erfahrungen haben Sie mit Halbgefangenschaft, also wenn Häftlinge tagsüber arbeiten gehen können und nur die Nächte im Vollzug verbringen?
Gute Erfahrungen.
Wie gehen Sie mit Insassen um, die zwar wenig handwerkliche, dafür aber eher akademische oder unternehmerische Fähigkeiten haben? Gibt es Modelle, die solche Kompetenzen besser nutzen?
Das in einer Strafanstalt vorhandene Arbeitsangebot ist in der Regel eher handwerklich ausgerichtet, auch aufgrund der Einschränkungen betreffend Nutzung von Computern bzw. Verbot des Internetzugangs. Jedoch können auch Eingewiesene, die mehr akademische Fähigkeiten haben, neue handwerkliche Fähigkeiten entwickeln und neue, ungewohnte Arbeitsfelder entdecken. Es ist zudem möglich, in der Freizeit oder beim Besuch von BiSt – Bildung im Strafvollzug – „akademische“ Fähigkeiten weiterzuentwickeln.
Wie wird mit Häftlingen umgegangen, die weiterhin ein eigenes Unternehmen führen oder zumindest Eigentümer einer Firma sind?
Alle eingewiesenen Personen sind zur zugewiesenen Arbeit in der Anstalt verpflichtet. Eingewiesene verfügen jedoch über Freizeit, die sie – innerhalb der geltenden Regeln – für sich nutzen können. Sie können mit den bestehenden Kommunikationsmitteln wie Briefverkehr, Telefon oder Festnetz mit der Aussenwelt kommunizieren.

Begnadigungen in der Schweiz
Begnadigungen sind in der Schweiz die grosse Ausnahme. Auf Bundesebene hat die Vereinigte Bundesversammlung seit 1997 gerade einmal elf Gesuche behandelt – zwei davon wurden gutgeheissen (1999 und 2002). Nach einer zwölfjährigen Pause lag 2020 wieder ein Dossier vor; das Parlament lehnte es ab. Die Zahlen illustrieren: «Gnade vor Recht» ist hierzulande ein Instrument für seltene Härtefälle, nicht für die Korrektur von Urteilen.
Dass das so ist, hat System. In der Schweiz entscheidet nicht die Regierung oder ein Staatsoberhaupt, sondern die Politik im Plenum – nach Vorberatung durch die Kommission für Begnadigungen und Zuständigkeitskonflikte (BeK). Die BeK prüft das Dossier, holt den Bericht des Bundesrats ein und stellt den Räten einen Antrag. Erst die Vereinigte Bundesversammlung entscheidet. Zuständig ist der Bund allerdings nur für Urteile von Bundesbehörden; in allen übrigen Fällen liegt die Begnadigungskompetenz bei den Kantonen.
Wie eng der Schweizer Rahmen gefasst ist, formuliert die BeK in einem Bericht nüchtern: «Die Begnadigung dient nicht dazu, ein rechtskräftiges Urteil zu korrigieren.» Gewährt werde sie in der Regel nur, wenn nach der Verurteilung erhebliche neue Umstände bekannt werden, der Vollzug «ungerechtfertigt hart» erschiene und die betroffene Person «gnadenwürdig» sei – also unter anderem Reue zeige oder Wiedergutmachung leiste. 2020 empfahl die BeK einstimmig die Ablehnung des vorliegenden Gesuchs; das Parlament folgte.
Die beiden letzten Bundes-Begnadigungen betrafen Wirtschaftsfälle am Rand des Alltags: 1999 wurde einer Person die Restbusse erlassen, die 282’421 Kilogramm zollbegünstigtes Heizöl als Diesel verkauft hatte – prekäre Finanzen und gezeigte Reue gaben den Ausschlag. 2002 begnadigte das Parlament einen Metzger, der rund eine Tonne Fleisch illegal eingeführt hatte; unfallbedingt erwerbsunfähig, hatte er die nachgeforderten 25’000 Franken Zoll und Steuern bezahlt.
Noch seltener ist Öffentlichkeit. Kantonale Verfahren laufen meist fern der Scheinwerfer: In Zürich erhalten die Kantonsrätinnen und -räte eine anonymisierte Sachverhaltszusammenfassung, wenn die Regierung eine Begnadigung beantragt. Begründungen sind zurückhaltend, die Entscheide bleiben politisch. In Basel-Stadt bereitet eine Begnadigungskommission die Gesuche vor; für einen Gnadenentscheid braucht es im Grossen Rat eine Mehrheit von mindestens 40 Ja-Stimmen bei mindestens 60 Anwesenden. Bern nennt die Begnadigung explizit einen «Eingriff in den Vollzug der Strafe» – eine Durchbrechung der strikten Gewaltenteilung, die den Ausnahmecharakter unterstreicht.
Formal ist die Rollenverteilung klar: Der Bund entscheidet nur, wenn Bundesstrafgericht oder Bundesbehörden geurteilt haben, die Kantone in allen übrigen Fällen – Gemeinden haben keine Zuständigkeit für strafrechtliche Begnadigungen. In der Praxis heisst das: Die überwiegende Zahl der Gesuche landet in kantonalen Parlamenten oder – je nach Rechtslage – bei den Regierungen; die Verfahren sind kurz, selten und diskret.
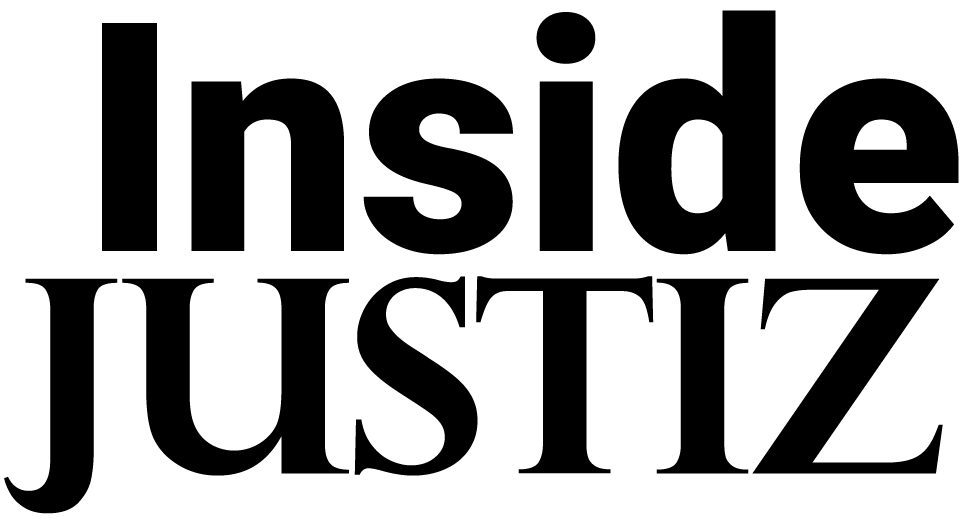
Wow, differenzierte Analyse-Kriterien von inside-justiz.ch!