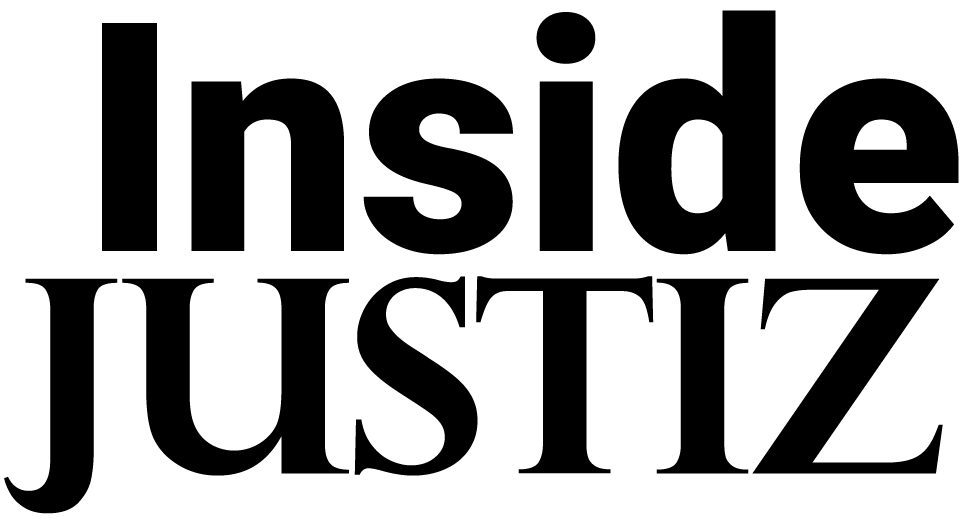Die Affäre um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein erlebt unter der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump eine neue Wendung – nicht durch Enthüllungen, sondern durch den Umgang der Regierung mit öffentlichem Druck. Der renommierte Strafrechtsprofessor Daniel C. Richman (Columbia Law School), früherer Bundesstaatsanwalt im Southern District of New York, nimmt dies in einem aktuellen Guest Essay in der New York Times zum Anlass für eine fundamentale Kritik: Das Justizministerium der Vereinigten Staaten, so Richman, habe „jegliche institutionelle Glaubwürdigkeit verspielt“.
«Das Trump-Justizministerium will jetzt aus einem Brunnen schöpfen, den es selbst vergiftet hat.»
Epstein, Maxwell – und die kalkulierte Nichtaufklärung
Ausgangspunkt von Richmans Analyse ist der neue Versuch der Trump-Administration, die öffentliche Empörung über Epsteins Verbindungen zu Eliten abzumildern. Nach Akteneinsicht und einem diskreten Interview mit der inhaftierten Ghislaine Maxwell – Epsteins frühere Komplizin – verkündete das Justizministerium lapidar, „dass keine weiteren Offenlegungen angezeigt oder gerechtfertigt“ seien. Wer hinter der Erklärung steht, bleibt bewusst ungenannt. Kein Name. Kein Gesicht. Keine Verantwortung.
«Niemand glaubt dieser Stellungnahme, und niemand soll sie glauben“, schreibt Richman. „Sie kommt von Pam Bondis Justizministerium und Kash Patels FBI – beides Institutionen, deren Beamtinnen und Beamte wissen, dass sie bei kleinsten Anzeichen mangelnder Loyalität ausgetauscht werden könnten.»
Das Prinzip Fealty statt Rechtsstaat
Richman zeichnet eine Justizverwaltung unter Donald Trump, in der das zentrale Auswahlkriterium für Führungspersonal nicht Fachlichkeit, sondern absolute Loyalität sei.
«Präsident Trump hat persönliche Treue über alles andere gestellt – und er scheint damit erfolgreich gewesen zu sein.»
Angeführt wird das Ministerium inzwischen von Pam Bondi, Trumps langjähriger politischer Verbündeter, flankiert von Personen wie Todd Blanche (ehemals Trumps persönlicher Anwalt) und Kash Patel, der bereits unter Trump als politisierter Sicherheitsbeamter in Erscheinung trat.
«Sie haben Ermittlungen eröffnet, die der Präsident forderte – ob es eine rechtliche Grundlage gab oder nicht. Und sie haben Verfahren beendet, wenn es ihm politisch nützte – ganz gleich, wie gross das öffentliche Interesse war.»
Institutionelles Misstrauen – auch im Gerichtssaal
Richman geht einen Schritt weiter: Nicht nur die Öffentlichkeit habe das Vertrauen verloren – auch Bundesrichterinnen und ‑richter signalisierten zunehmend Zweifel am professionellen Handeln der Regierung.
«Zahlreiche Richterinnen und Richter haben – vorsichtig formuliert – Bedenken geäussert gegenüber der offensichtlichen Priorisierung politischer Opportunität über Rechtsstaatlichkeit.»
Das hat konkrete Folgen im Gerichtssaal: Wenn Regierungsanwälte Aussagen nicht machen können, weil sie von oben keine Informationen erhalten – oder gar lügen, um den Präsidenten zu schützen –, werden sie zu gewöhnlichen Anwälten. Oder wie Richman es formuliert:
«… und zwar zu schmierigen Anwälten. Und der Fall der Regierung leidet – wie es auch sein sollte.»
Die Maxwell-Gespräche: Aufklärung oder politische Reinszenierung?
Besonders kritisch beurteilt Richman die Gespräche mit Ghislaine Maxwell, die eine 20-jährige Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs verbüsst. Dass sie nun aussagen soll, sei politisch motiviert – entweder, um Trump von Mitwisserschaft zu entlasten oder um einen Befreiungsschlag in der Öffentlichkeit zu inszenieren. Laut Richman gibt es Hinweise, dass Maxwell im Gegenzug Immunität oder eine Begnadigung in Aussicht gestellt wurde.
«Dass Trump öffentlich verkündete, er dürfe Maxwell begnadigen, lässt tief blicken.»
Doch was auch immer Maxwell preisgibt – wer garantiert, dass ihre Aussagen vollständig offengelegt werden? Oder dass kritische Details nicht unter Verschluss bleiben, weil sie Trump belasten könnten?
«Was, wenn sie spricht – auch über den Präsidenten –, aber niemand hinhört oder Bericht erstattet?»
Politische Einflussnahme und strukturelle Schwächung der Justiz
Richmans Essay lässt sich auch aus europäischer Perspektive als warnendes Beispiel lesen. Die Aushöhlung institutioneller Glaubwürdigkeit – etwa durch politisch motivierte Personalentscheide oder selektive Strafverfolgung – steht im Widerspruch zu den rechtsstaatlichen Prinzipien westlicher Demokratien. Besonders in Ländern wie Ungarn, Polen oder neuerdings auch Israel lassen sich ähnliche Entwicklungen beobachten: Richter werden ausgetauscht, Verfahren verschleppt, Staatsanwaltschaften instrumentalisiert.
Auch in der Schweiz wurden in den letzten Jahren wiederholt Debatten über politische Einflussnahme auf Richterwahlen, die Nähe von Staatsanwaltschaften zur Exekutive oder fragwürdige Verfahrensabläufe geführt. Der Fall erinnert an Warnungen von Schweizer Juristen wie Lorenz Langer oder Konrad Jecker , die auf eine zunehmende Politisierung der Justiz aufmerksam machten.
Die Krise ist nicht die Maxwell-Aussage – sondern das System dahinter
Daniel Richman macht in seinem Essay deutlich, dass es nicht primär um den Fall Epstein oder die Aussage von Ghislaine Maxwell geht – sondern um das System Trump, das ein einst respektiertes Justizministerium zu einem politischen Werkzeug umgebaut hat.
«Die Menschen erwarten Wahrheit von diesem Justizministerium. Das Problem ist: Die Regierung hat genau jene Institution zerstört, die diese Wahrheit liefern könnte.»
Der Beitrag von Richman ist nicht nur eine juristische Analyse, sondern eine eindringliche Mahnung – und eine Aufforderung, den Wert von institutioneller Glaubwürdigkeit, richterlicher Unabhängigkeit und transparenter Strafverfolgung auch in anderen Ländern nicht zu unterschätzen.
Titelbild: (oben links) Jeffrey Epstein (New York State Sex Offender Registry) , (oben Mitte) Donald J. Trump, (oben rechts) Ghislaine Maxwell (Metropolitan Detention Center, Brooklyn), unten links ) Kash Patel, FBI-Direktor, (unten Mitte) Pam Bondi, US-Justizministerin, (unten rechts) Todd Blanche, stellvertretender US-Justizminister.

Daniel C. Richman
Daniel C. Richman ist einer der renommiertesten Strafrechtsprofessoren der Vereinigten Staaten. Er lehrt seit 2007 an der Columbia Law School in New York, wo er den angesehenen Lehrstuhl des Paul J. Kellner Professor of Law innehat. Seine juristische Laufbahn begann er mit Studien an der Harvard University (A.B., summa cum laude) und an der Yale Law School (J.D.), wo er als Redakteur der Yale Law Journal tätig war. Es folgten prestigeträchtige Stationen als juristischer Assistent (Clerk) beim legendären Supreme-Court-Richter Thurgood Marshall und beim Berufungsgericht des Second Circuit unter Wilfred Feinberg.
Von 1987 bis 1992 arbeitete Richman als Assistant United States Attorney im Southern District of New York, einer der bedeutendsten Staatsanwaltschaften des Landes. Dort stieg er zum Chief Appellate Attorney auf. Seither verbindet er Forschung, Lehre und politische Beratung: Er war unter anderem als Special Government Employee für das FBI tätig und beriet das US-Justizministerium sowie das Finanzministerium in strafrechtlichen Fragen.
Bekannt wurde Richman auch über Fachkreise hinaus, als er 2017 als Vertrauensperson des damaligen FBI-Direktors James Comey auftrat. Richman war es, der den Inhalt eines von Comey verfassten Memos an die New York Times weitergab – ein Schritt, der wesentlich zur Einsetzung von Sonderermittler Robert Mueller in der Russland-Affäre beitrug. Medien wie die New York Times, The Atlantic und Lawfare greifen seither regelmässig auf seine Expertise zurück.
Seine wissenschaftliche Arbeit konzentriert sich auf das amerikanische Bundesstrafrecht, auf Strafprozessrecht, Cyberkriminalität, Überwachungspolitik sowie auf Fragen zur politischen Einflussnahme auf Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden. Richman gilt als präziser Kritiker struktureller Korruption und als analytisch scharfer Beobachter der Erosion rechtsstaatlicher Prinzipien in den USA.
Für seine akademische Lehre wurde er mit dem Presidential Teaching Award der Columbia University ausgezeichnet – eine der höchsten Ehrungen der Hochschule.