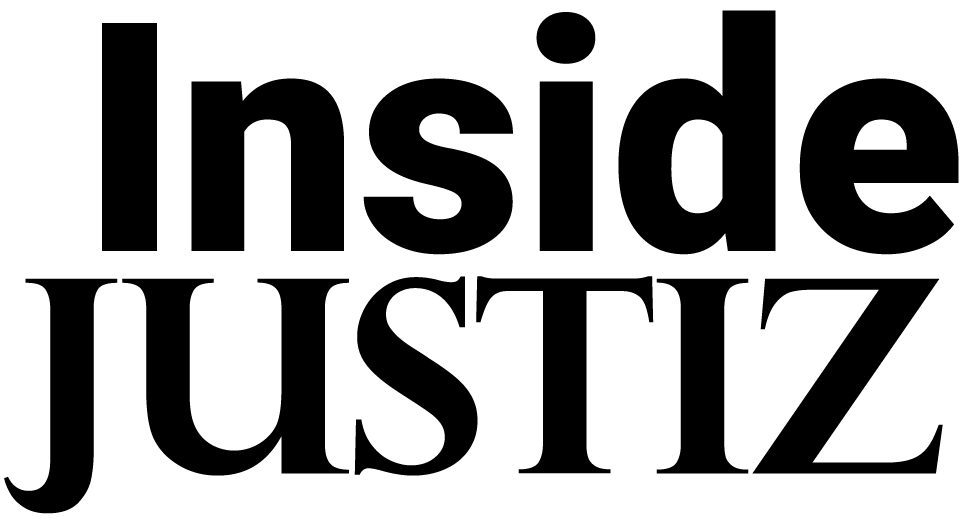Im Fall Block stehen sich Christina Block, Unternehmerin aus der Hamburger Block-Familie, und ihr früherer Partner Stephan Hensel gegenüber. Im Kern geht es um die beiden jüngeren Kinder – strafrechtlich um die mutmassliche Entführung in der Silvesternacht 2023/24 vor dem Landgericht Hamburg, familienrechtlich um Sorgerecht und Umgang in Dänemark. Die Verfahren laufen parallel, nähren sich gegenseitig und verlagern den Konflikt regelmässig von der Aktenlage in die Öffentlichkeit.
Explosiv wurde der Fall durch die besondere Mischung aus Prominenz, internationalen Zuständigkeiten und starken Bildern: Hausdurchsuchungen, Sicherheitsnarrative, ein vielzitierter Hof auf dem Land – und schliesslich professionelle Prozesskommunikation mit PR-Akteuren wie Béla Anda. Beide Seiten bedienen Medien mit Informationen und Bewertungen; Anwälte setzen pointierte Statements, Redaktionen protokollieren jede Wendung. So entstand ein hoch emotionales Verfahren, in dem Litigation-PR sichtbar den Takt der öffentlichen Erzählung mitbestimmt.
Gezielt mit Informationen bedienen
Der Fall Block zeigt in seltener Dichte, wie stark Straf- und Familienverfahren heute von einer zweiten Bühne begleitet werden: der öffentlichen Deutung. Parallel zu den juristischen Akten laufen hochgetaktete Kommunikationslinien, auf denen beide Seiten Medien gezielt mit Informationen bedienen, Bewertungen platzieren und Empathie binden. Anwälte empören sich vor laufender Kamera, Sprecher rahmen Ereignisse sofort nach jedem Verhandlungstag, Redaktionen protokollieren diese Töne zuverlässig – nicht aus Parteilichkeit, sondern weil Konflikt, Personalisierung und Verdichtung Nachrichtenwert schaffen. So entstehen zwei klare Werteframes, die den Fall tragen: „Schutz der Kinder vor Gefahr“ einerseits, „Recht der Mutter auf Kontakt“ andererseits. Jede Wendung im einen Verfahrensstrang (straf- oder familienrechtlich) wird im anderen kommunikativ verwertet und verstärkt.
Für die Litigation-PR ist Block damit ein Lehrbeispiel: Professionelle Prozesskommunikation ist kein Beiwerk mehr, sondern Teil des prozessualen Umfelds. Sie arbeitet mit definierten Sprechrollen, klaren Kernbotschaften und präzisem Timing – sichtbar, aber regelkonform. Wo Kommunikationsprofis das Taktgefühl mitbringen, lassen sich Vorverurteilungen dämpfen, Reputation stabilisieren und Deutungshoheit behaupten; wo Grenzen zur Schau überschritten werden, drohen Rückschläge im Saal (etwa Zeugenprobleme) und Vertrauensverluste. Der Fall demonstriert beides – und macht deutlich, dass seriöse Litigation-PR heute zur Grundausstattung jeder Verteidigungs- und Interessenstrategie gehört.
Resonanzraum
Der Fall Block führt vor, wie sehr moderne Verfahren nicht nur im Gerichtssaal, sondern auch im öffentlichen Resonanzraum entschieden werden. Neben den Akten läuft ein zweites, hochgetaktetes Verfahren: das Ringen um Narrative, Empathie und Glaubwürdigkeit. In Hamburg verhandelt die Strafkammer die mutmassliche Entführung in der Silvesternacht 2023/24; parallel werden familiengerichtliche Entscheidungen und Verfahrensschritte innert Stunden medial gerahmt, kommentiert und zu neuen Positionierungen genutzt. Dieser permanente Übersetzungsprozess – vom juristischen Vorgang zur öffentlichen Deutung – ist das Feld der Litigation-PR.
Beide Lager bespielen dieses Feld professionell. Auf Seiten von Christina Block ist die Prozesskommunikation sichtbar zentralisiert: Mit Béla Anda hat sie einen seltenen Doppelprofi verpflichtet, der sowohl die politische Regierungskommunikation aus dem Kanzleramt kennt als auch den Boulevard- und Nachrichtenbetrieb aus der Chefredaktionsebene der BILD. Anda rahmt den Fall konsequent entlang einer Werteformel («Eine Mutter hat das Recht, ihre Kinder zu sehen») und kommuniziert seine Rolle offen – ein Signal an Medien und Öffentlichkeit, dass hier nicht nur verteidigt, sondern auch gestaltet wird. Dass er zu Beginn der Hauptverhandlung des Saals verwiesen wurde, weil er als möglicher Zeuge in Betracht kommt, markiert die Kante, an der Prozessordnung und öffentliche Interessenvertretung aufeinanderprallen. Genau dort entscheidet sich oft, ob Litigation-PR als seriöse Einordnung oder als Grenzgängerei wahrgenommen wird.
Kernbotschaften
Auch die Gegenseite arbeitet mit hoher Schlagzahl und bildstarken Motiven. Der Vater schildert in und neben dem Saal ein Umfeld von Bedrohung und Observation; Medien greifen diese Details auf, protokollieren sie in Live-Tickern und Stückberichten und verankern damit ein Sicherheits-Narrativ, das weit über den konkreten Beweiswert des Einzelfalls hinauswirkt. Der Effekt ist typisch: Starke Bilder – Alarmknöpfe, private Sicherheitsdienste, verdeckte Beobachtung – erzeugen beim Publikum sofortigen Sinn; juristische Differenzierung folgt oft erst später. Litigation-PR transformiert solche Bilder in konsistente Kernbotschaften, wiederholt sie plattformübergreifend und zwingt die Gegenseite zur Reaktion. So entsteht eine dynamische Framing-Kaskade, die den sozialen Kontext des Verfahrens prägt.
Zur Intensität des medialen Schlagabtauschs tragen die Anwälte beider Seiten bei. Empörung wird – bewusst oder unbewusst – zum Kommunikationsstilmittel: pointierte Vorwürfe, zugespitzte Bewertungen, Forderungen nach Fairness oder Transparenz. Redaktionen protokollieren diese Markierungen verlässlich, weil sie Nachrichtenwert erzeugen, Rollen klären und Konflikt sichtbar machen. Wo Grenzen verlaufen, prüfen Gerichte auf Nebenschauplätzen: Eilverfahren zu streitigen Aussagen oder Verwertungsfragen zeigen, wie eng juristische Zulässigkeit und öffentliche Kommunikation verzahnt sind – und wie prägend diese Nebenlinien für die Hauptlinie werden.
Deutungshoheit
Der Fall zeigt zudem, wie professionell orchestrierte Taktung funktioniert. Entscheid, Verhandlungstag, Zwischenruf: Jede Zäsur wird kommunikativ verwertet – mit Statements unmittelbar nach dem Termin, mit exklusiven Platzierungen in reichweitenstarken Medien und mit flankierenden Social-Posts. Das erzeugt eine Erzählbewegung, in der nicht nur Fakten, sondern auch Deutungshoheit verhandelt wird. Wer in dieser Phase schweigt, verliert Terrain; wer zu laut wird, riskiert Rückschläge im Saal – vom Glaubwürdigkeitsverlust bis zur Zeugenproblematik, wie der Saalverweis von Béla Anda demonstriert.
Aus Litigation-PR-Sicht lässt sich der Fall als Lehrbuch in Echtzeit lesen: Zwei konkurrierende Werteframes stehen sich gegenüber – «Recht der Mutter auf Kontakt» versus «Schutz der Kinder vor Gefahr». Beide sind einfach, emotional anschlussfähig und über Wochen wiederholbar. Anwälte liefern die zugespitzten Ankerpunkte, PR-Akteure sorgen für Konsistenz und Taktung, Redaktionen dokumentieren und verstärken – nicht aus Parteilichkeit, sondern weil Konflikt, Personalisierung und Verdichtung zum Raster professioneller Nachrichtenproduktion gehören. Je länger der Prozess dauert, desto stärker verselbständigt sich diese Erzählung; sie wirkt auf Zeugen, Umfeld, Entscheidungsträger – nie deterministisch, aber spürbar. Genau deshalb betonen seriöse Praktiker Leitplanken: klare Trennung von Tatsache und Bewertung, keine persönlichen Diffamierungen, nachweisbare Faktenbasis und Respekt vor der Prozessordnung. Dort entscheidet sich, ob Litigation-PR den Rechtsstaat ergänzt – oder ihm in der Wahrnehmung Konkurrenz macht.
Am Ende steht ein nüchterner Befund: Der Fall Block ist keine Kommunikationspanne, sondern eine Kommunikationsleistung auf beiden Seiten. Er zeigt, dass moderne Verteidigung und Interessenvertretung ohne strategische Öffentlichkeitsarbeit kaum noch auskommen – und dass justizielle Entscheidungen heute in einem Klima fallen, das von juristischen Gründen und öffentlichen Bedeutungen zugleich aufgeheizt wird. Litigation-PR ist in diesem Gefüge keine Show, sondern der Versuch, Deutungskämpfe zu ordnen, Empathie zu steuern und faire Verfahren gegen mediale Vorverurteilungen abzuschirmen – sichtbar, regelkonform und jederzeit angreifbar. Genau darin liegt ihr Reiz und ihre Gefahr.

Was will Litigation-PR?
Litigation-PR ist strategische Kommunikation in laufenden oder absehbaren rechtlichen Verfahren. Sie soll Reputation schützen, Vorverurteilungen verhindern und das Verständnis komplexer Sachverhalte ermöglichen – ohne den Rechtsstaat zu ersetzen. Kernelemente sind klare Kernbotschaften, definierte Sprecherrollen (Anwälte, Betroffene, Experten) und präzises Timing entlang von Verhandlungstagen und Entscheiden.
Litigation-PR entstand in den USA (Medienprozesse seit den 1980ern) und später in Deutschland professionalisiert, hat sich Litigation-PR von einer Krisen-Teildisziplin zur eigenen Praxis entwickelt. Prägend waren prominente Fälle, in denen mediale Deutung das Verfahren spürbar beeinflusste (z. B. Kachelmann in Deutschland; international Banken- und Compliance-Fälle).
In der Schweiz ist Litigation-PR noch jung. Ausbildung und Standespraxis betonen das Schriftliche, während öffentliche Kommunikation oft improvisiert bleibt. Staatsanwaltschaften treten proaktiv auf; Betroffene und Verteidigung reagieren häufig zu spät oder gar nicht – mit Risiken für Deutungshoheit und Reputation. Zunehmend entstehen jedoch spezialisierte Teams und Leitplanken (Fakten vor Wertung, Trennung von Recht und Kommentar, Respekt der Prozessordnung).
Litigation-PR wird fester Teil der Verteidigungs- und Interessenstrategie: frühzeitige Planung, digitale Formate, Faktenchecks in Echtzeit. Erwartbar sind Soft-Standards (z. B. „Swiss Code of Litigation-PR“), mehr Transparenz zur Rolle von Beratern und eine engere Verzahnung von Kanzleien und Kommunikation – mit einem Ziel: öffentliche Einordnung erleichtern, ohne eine „parallele Jurisdiktion“ zu erzeugen.
Was will Litigation-PR?
Litigation-PR ist strategische Kommunikation in laufenden oder absehbaren rechtlichen Verfahren. Sie soll Reputation schützen, Vorverurteilungen verhindern und das Verständnis komplexer Sachverhalte ermöglichen – ohne den Rechtsstaat zu ersetzen. Kernelemente sind klare Kernbotschaften, definierte Sprecherrollen (Anwälte, Betroffene, Experten) und präzises Timing entlang von Verhandlungstagen und Entscheiden.
Litigation-PR entstand in den USA (Medienprozesse seit den 1980ern) und später in Deutschland professionalisiert, hat sich Litigation-PR von einer Krisen-Teildisziplin zur eigenen Praxis entwickelt. Prägend waren prominente Fälle, in denen mediale Deutung das Verfahren spürbar beeinflusste (z. B. Kachelmann in Deutschland; international Banken- und Compliance-Fälle).
In der Schweiz ist Litigation-PR noch jung. Ausbildung und Standespraxis betonen das Schriftliche, während öffentliche Kommunikation oft improvisiert bleibt. Staatsanwaltschaften treten proaktiv auf; Betroffene und Verteidigung reagieren häufig zu spät oder gar nicht – mit Risiken für Deutungshoheit und Reputation. Zunehmend entstehen jedoch spezialisierte Teams und Leitplanken (Fakten vor Wertung, Trennung von Recht und Kommentar, Respekt der Prozessordnung).
Litigation-PR wird fester Teil der Verteidigungs- und Interessenstrategie: frühzeitige Planung, digitale Formate, Faktenchecks in Echtzeit. Erwartbar sind Soft-Standards (z. B. „Swiss Code of Litigation-PR“), mehr Transparenz zur Rolle von Beratern und eine engere Verzahnung von Kanzleien und Kommunikation – mit einem Ziel: öffentliche Einordnung erleichtern, ohne eine „parallele Jurisdiktion“ zu erzeugen.
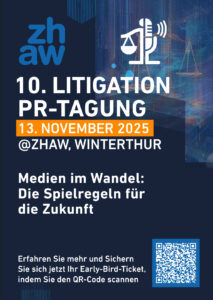
10. Litigation-PR-Tagung
in Winterthur
13. NOVEMBER 2025
Die 10. Litigation-PR-Tagung ist der Leuchtturm-Event für alle, die Verfahren nicht nur juristisch, sondern auch kommunikativ gewinnen wollen.
Am Donnerstag, 13. November 2025, verwandelt die ZHAW School of Management and Law in Winterthur ihre Aula in ein Labor für moderne Prozesskommunikation. Gastgeber Prof. Patrick L. Krauskopf, Stephan Rösli und Céline Scherrer setzen unter dem Leitmotiv «Medien im Wandel – die Spielregeln für die Zukunft» die Tonspur für die Branche: Wie setzt man Narrative rechtssicher? Wie reagiert man in Echtzeit auf Live-Ticker, Social Feeds und Schlagzeilen? Wie hält man die Leitplanken ein und bleibt trotzdem durchsetzungsstark?
An der Tagung treten führende Persönlichkeiten aus Politik, Medien, Wirtschaft und Wissenschaft auf – darunter Ständerätin Esther Friedli, bauenschweiz-Direktorin Cristina Schaffner sowie SonntagsZeitung-Chefredaktor Arthur Rutishauser. Es erwartet Sie ein vielfältiges Programm mit Vorträgen, Diskussionen und zahlreichen Austauschmöglichkeiten.
Auf der Bühne und im Saal treffen sich Namen, die Litigation-PR täglich prägen und herausfordern: Moritz Leuenberger bringt die Perspektive des politischen Krisenmanagements, Nik Gugger liefert Impulse aus der Bundespolitik, Armin Wolf (ORF) zeigt, wie man unter Druck präzise fragt und präzise antwortet, Florian Klenk (Falter) und Marcel Kohler (TX Group) öffnen die Redaktionssicht auf Tempo, Timing und Quellenlage, Monica Fahmy und Sven Millischer sprechen über Glaubwürdigkeit, Recherche und Verantwortung im medialen Gerichtssaal, Colin Porlezza (USI) ordnet die Plattform- und Algorithmenlogik ein, Cristina Schaffner (bauenschweiz) bringt die Verbands- und Allianzenperspektive.
Die Reihe hat Tradition und Strahlkraft: In früheren Ausgaben gaben Alt-Bundesrat Adolf Ogi und Alt-Bundesrat Kaspar Villiger am Abend ihre Einordnung – ein Brückenschlag zwischen politischer Entscheidungskultur und öffentlicher Kommunikation, der Litigation-PR heute massgeblich prägt.
Die Jubiläumsausgabe denkt Litigation-PR als Praxis: Fallanalysen mit echten Cases, Live-Analyse von Medienstatements, Werkstattgespräche zu Sprechrollen, Kernbotschaften und Fact-Checking in Echtzeit, Simulationen zu «Do/Don’t» bei heiklen Verfahrenssituationen – vom Umgang mit Leaks bis zur Frage, wann man schweigt und wann man setzt.
Wer aus Kanzlei, Justiz, Unternehmen, Verband oder Redaktion kommt, profitiert doppelt: juristisch belastbare Standards, die im Saal bestehen, und kommunikative Strategien, die draussen tragen. Dazu kommt das Netzwerk: Entscheiderinnen und Entscheider aus Recht, Medien, Politik und Kommunikation auf engem Raum, kurze Wege zu Redaktionen, schnelle Feedbackschleifen zu Argumentationslinien, Kontakte zu spezialisierten Litigation-PR-Teams.
Wer Litigation-PR nicht nur verstehen, sondern anwenden will, gehört in die Aula der ZHAW. Programm, Anmeldung, Networking – alles an einem Ort.
https://litigation-pr.ch/