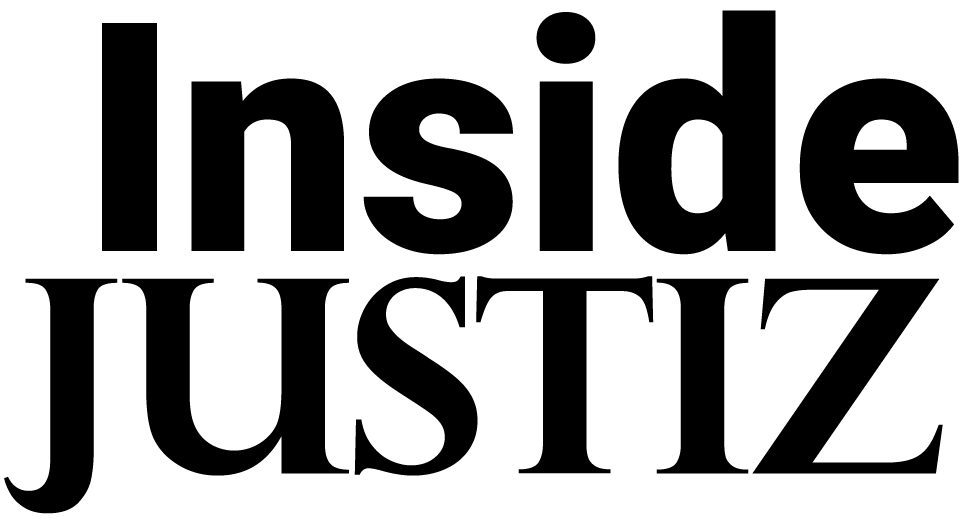Quellenschutz ist kein Luxus, sondern Infrastruktur der Demokratie. Ohne ihn verstummen Whistleblower, werden Missstände unsichtbar, bleibt die Gesellschaft blind. Doch die Schweiz lebt seit Jahren mit einem Paradox: Die Justiz soll Geheimnisverrat ahnden, hat aber bei Leaks an Medien kaum prozessuale Werkzeuge – weil das Gesetz den Schutz extrem weit zieht. Staatsanwalt Damian K. Graf (Bild unten) stellt diese Asymmetrie in seinem Beitrag auf Medialex ins Schaufenster und fordert eine präzise Korrektur. Der Streit ist mehr als eine Fachfrage für Juristen und Journalisten – er betrifft das Selbstverständnis eines demokratischen Staates, der Öffentlichkeit, Transparenz und Kontrolle verspricht.
Staatsanwalt Damian K. Graf kritisiert, dass die Strafverfolgung von Geheimnisverletzungen in der Schweiz regelmässig ins Leere läuft, weil der Quellenschutz der Medien sehr weit reicht. Zwar betont er, dass Medienschaffende nicht vor den Strafrichter gehören und ihr Zeugnisverweigerungsrecht sowie das Beschlagnahmeverbot auch künftig vollumfänglich gelten sollen. Doch er schlägt vor, diese Schutzrechte räumlich zu begrenzen: Geschützt bleibt alles, was im Gewahrsam von Journalistinnen und Journalisten oder innerhalb einer Redaktion liegt. Befinden sich Aufzeichnungen oder Daten jedoch bei einer tatverdächtigen Quelle, soll ein Zugriff der Strafverfolgung möglich sein. Mit diesem Modell orientiert sich Graf an der deutschen Strafprozessordnung, die eine ähnliche Abgrenzung kennt. Konkret soll dazu aus Art. 264 StPO die Formulierung «ungeachtet des Ortes, wo die Aufzeichnungen sich befinden», gestrichen werden, um den Quellenschutz ausserhalb der Redaktionsräume aufzuheben.
Effizienz der Strafverfolgung verbessern
Für Graf spricht, dass seine Reform die Effizienz der Strafverfolgung verbessern würde. Verfahren wegen Amts- oder Geschäftsgeheimnisverletzungen, die heute meist mangels verwertbarer Beweise scheitern, könnten damit zumindest in jenen Fällen weitergeführt werden, in denen Beweismittel ausserhalb der journalistischen Sphäre lagern. Der Vorstoss schliesst also eine Lücke, ohne Medienschaffende direkt zu kriminalisieren. Zudem würde damit klarer zwischen Pressefreiheit und Strafanspruch unterschieden: Journalistinnen und Journalisten blieben geschützt, während Quellen nicht länger vollständig immunisiert wären. Dass Deutschland seit Jahren mit einem ähnlichen Modell arbeitet, gibt dem Vorschlag Gewicht.
Grafs Reformidee zielt darauf ab, den Quellenschutz räumlich zu begrenzen, indem die Formulierung «ungeachtet des Ortes, wo die Aufzeichnungen sich befinden» aus Art. 264 StPO gestrichen wird. Damit würde das Beschlagnahmeverbot weiter gelten, solange sich Dokumente im Gewahrsam von Journalisten oder ihrer Redaktion befinden – nicht jedoch, wenn die fraglichen Unterlagen bei der Quelle lagern. Rechtlich bleibt aber unklar, wie diese Sphäre in Zeiten von Cloud‑Speicherung, Homeoffice und dezentralen Redaktionsstrukturen gezogen werden soll. Welche Aufzeichnungen gelten noch als „journalistische“ Unterlagen, welche fallen in die private Sphäre der Informanten? Dieses Abgrenzungsproblem birgt neue Grauzonen und erhöht das Risiko, dass Ermittlungsbehörden und Gerichte den Quellenschutz im Zweifel eher verneinen.
Einwendungen
Kritiker warnen, dass schon die Möglichkeit einer Strafverfolgung potenzielle Hinweisgeber abschreckt. Quellen könnten Informationen zurückhalten aus Furcht vor Enttarnung und Sanktionen. Hinzu kommt die Gefahr unklarer Abgrenzungen: Wo genau endet die journalistische Sphäre, wo beginnt die der Quelle? Unscharfe Kriterien könnten Ermessensspielräume eröffnen – und aktuelle Vorfälle zeigen, wie solche Spielräume genutzt werden können. In St. Gallen hat ein Staatsanwalt kürzlich per Editionsverfügung versucht, die Korrespondenz und IP-Daten einer Redaktion offenzulegen, um einen anonymen, beleidigenden Kommentar zurückzuverfolgen. Die Staatsanwaltschaft betont zwar, das Redaktionsgeheimnis sei nicht tangiert gewesen; für die Medienbranche ist der Fall dennoch ein Warnsignal: Wenn schon ein Bagatellfall solche Schritte auslöst, wie weit würde ein erweitertes Zugriffsrecht in brisanteren Fällen gehen?
Auch die internationalen Standards setzen hohe Hürden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte betrachtet den Quellenschutz als Eckpfeiler der Pressefreiheit – Ausnahmen sind nur bei überwiegendem öffentlichem Interesse zulässig. Ob gewöhnliche Amts- oder Geschäftsgeheimnisverletzungen diese Schwelle erreichen, ist fraglich. Zudem kennt die Schweiz (anders als viele EU-Länder) bis heute kein umfassendes Whistleblower-Schutzgesetz; ein Vorstoss im Parlament scheiterte 2020. Informanten fehlt damit jeglicher gesetzlicher Schutz oder Rechtfertigungsgrund. Grafs Reform würde zwar die Strafverfolgung von Informanten erleichtern, bietet ihnen jedoch keinerlei Immunität – eine Schieflage, die die Bereitschaft, Missstände offenzulegen, weiter verringern dürfte. Ohne flankierende Massnahmen wie einen Whistleblower-Schutz oder Anpassungen beim Bankgeheimnis droht so eher ein Chilling Effect als mehr Aufklärung: Der Quellenschutz würde ausgehöhlt, ohne dass die gesellschaftlich erwünschte Aufarbeitung von Missständen tatsächlich erleichtert würde.
Unterm Strich steht Grafs Vorschlag damit zwischen zwei Polen: Auf der einen Seite das berechtigte Interesse an einer funktionsfähigen Strafverfolgung, auf der anderen Seite die Gefahr, das Vertrauen in den Quellenschutz – und damit in die demokratische Kontrollfunktion der Medien – zu schwächen.
Der gesellschaftliche Wert des Quellenschutzes
Quellenschutz ist nicht nur ein berufsständisches Privileg für Journalisten – er ist ein Schutzgut der Gesellschaft. Wenn Quellen nicht sicher sind, erfahren wir nicht, wie Banken Steuerschlupflöcher ermöglichen, wie Behörden in Krisen versagen oder wie Konzerne Umweltstandards umgehen. Jeder Eingriff in diesen Schutz hat deshalb einen abschreckenden Chilling Effect: Quellen schweigen, investigative Geschichten bleiben ungeschrieben, das demokratische Korrektiv wird geschwächt.
Die Schweizer Rechtsordnung garantiert diesen Schutz deutlich: Art. 17 der Bundesverfassung sichert Medienfreiheit und Redaktionsgeheimnis; Art. 172 und Art. 264 Abs. 1 lit. c StPO gewähren Journalistinnen und Journalisten ein Zeugnisverweigerungsrecht sowie ein Beschlagnahmeverbot – Letzteres ausdrücklich «ungeachtet des Ortes, wo sich die Aufzeichnungen befinden». Eingriffe sind nur bei eng umschriebenen schwersten Delikten zulässig.
Graf argumentiert, diese Schranken gingen zu weit – insbesondere weil der Schutz “mitwandert”, wenn Informanten selbst über Aufzeichnungen verfügen, und Ermittlungen so fast zwangsläufig scheitern. Er plädiert deshalb dafür, den Quellenschutz auf die journalistische Sphäre zu begrenzen: Innerhalb von Redaktionen bliebe der Schutz absolut; ausserhalb – etwa bei der Quelle – soll er entfallen. Dieses Modell lehnt sich an das deutsche Vorgehen an.
Die von Graf angestossene Debatte ist folglich mehr als eine juristische Spitzfindigkeit: Sie entscheidet darüber, wie viel Öffentlichkeit wir als Gesellschaft zulassen – und wie viel Intransparenz wir akzeptieren.
Die Bankgeheimnis-Sonderstellung der Schweiz
Besonders bizarr ist der Widerspruch beim Bankgeheimnis. Art. 47 BankG kriminalisiert nicht nur Bankangestellte, sondern ausdrücklich auch Journalistinnen, Journalisten und andere Dritte, wenn sie ihnen zugespieltes Geheimmaterial veröffentlichen. Seit der Revision von 2015 drohen dafür bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe – unabhängig vom öffentlichen Interesse. In der Praxis führt das dazu, dass Behörden nach Leaks nicht etwa gegen Korruption oder Geldwäscherei ermitteln, sondern gegen Medienschaffende und ihre Quellen.
Das führt zu teils absurden Konstellationen: Während internationale Medien von Enthüllungen wie «SwissLeaks» bis «Panama Papers» ungehindert berichten konnten, mussten Schweizer Redaktionen grösstenteils zusehen oder auf die Recherchen ausländischer Kollegen verweisen. Medienfreiheits-Organisationen und Experten haben diese Situation mehrfach scharf kritisiert. Für sie ist es ein eklatanter Widerspruch, wenn die Schweiz einerseits Quellenschutz nahezu absolut gewährt, andererseits Medienschaffende kriminalisiert, sobald es um die wichtigste Industrie des Landes geht.
Grafs Reformvorschlag würde dieses Spannungsfeld kaum auflösen – im Gegenteil. Zwar prangert Graf in seinem Fachartikel die Kriminalisierung von Medienschaffenden durch Art. 47 BankG an, doch sein Modell eines räumlich begrenzten Quellenschutzes nähme Hinweisgebern im Finanzsektor den letzten verbleibenden Schutz, ohne den Grundkonflikt zu beheben. Solange Art. 47 BankG in der heutigen Form gilt, bleiben Journalistinnen und Journalisten strafrechtlich verantwortlich, wenn sie Bankdaten publizieren. Wird gleichzeitig der Quellenschutz ausserhalb der Redaktion aufgehoben, sind Whistleblower völlig dem Gesetzesrisiko ausgesetzt. Das Ergebnis wäre eine doppelte Rechtsschere: Informanten riskieren Strafverfolgung und verfügen – anders als Journalisten – über kein Zeugnisverweigerungsrecht, während Missstände im Bankensektor weiterhin kaum ans Licht gelangen.
Eine mögliche Lösung wäre eine ausdrückliche Interessenabwägung im Bankengesetz, die Art. 10 EMRK (Meinungs- und Medienfreiheit) berücksichtigt. Das öffentliche Interesse an einer Enthüllung müsste gegen das Geheimhaltungsinteresse abgewogen werden. Nur eine solche Klausel würde sicherstellen, dass investigative Recherchen nicht per se kriminalisiert werden, sondern nur in Ausnahmefällen mit überwiegenden Gegeninteressen untersagt bleiben.
Stimmen aus Gesellschaft und Politik
Reporter ohne Grenzen Schweiz feierte die jüngsten Bundesgerichtsentscheide – etwa im Corona-Leaks-Verfahren – als «Grundsatzentscheid zugunsten der Medienfreiheit». Auf politischer Ebene herrscht dagegen Uneinigkeit. Linksliberale Stimmen warnen, dass eine Lockerung des Quellenschutzes das Machtgefälle zwischen Bürger und Staat vergrössern würde. Bürgerlich-konservative Kräfte zeigen hingegen Verständnis für die Strafverfolgung: Geheimnisverrat müsse geahndet werden, und der Staat dürfe nicht sehenden Auges zulassen, dass seine Normen faktisch ins Leere laufen. International wird die Schweiz immer wieder kritisiert – insbesondere wegen des Bankgeheimnisses. Die OECD rügt den fehlenden Whistleblower-Schutz, während EU-Vertreter die Kriminalisierung der Bankberichterstattung als «schräge Gesetzgebung» bezeichnen.
Präzedenzfälle
- Corona-Leaks (2025): Das Bundesgericht untersagt die Auswertung versiegelter Daten zwischen einem Bundes-Insider und dem CEO der Ringier-Gruppe. Die Indiskretion bleibt unaufgeklärt; Medienfreiheit obsiegt, Strafverfolgung verliert.
- Inside Paradeplatz (2025): Erste Hausdurchsuchung bei einem Journalisten seit Jahrzehnten – doch das Zürcher Zwangsmassnahmengericht stoppt die Auswertung. Der Quellenschutz triumphiert.
- Blocher/Hildebrand (2014): Das Bundesgericht bestätigt den Schutz «ungeachtet des Ortes» – ein Grundpfeiler des heutigen Maximalschutzes.
- Burgermeister/Inside-Justiz (2023–2024): Ein St. Galler Staatsanwalt verlangt per Editionsverfügung die Herausgabe von Redaktionsdaten, um einen anonymen Online-Kommentar aufzudecken. Der Fall zeigt: Selbst Bagatellen können zu Eingriffen in die journalistische Vertrauenssphäre führen.
- Fall Raiffeisen/Inside Paradenplatz (2025) Staatsanwaltschaft durchsucht Redaktion von «Inside Paradeplatz» sowie in der Privatwohnung von Lukas Hässig wegen des Verdachts auf Verletzung des Bankgeheimnisses.
Die Schweiz schützt ihre Medienschaffenden stärker als viele Nachbarstaaten – vielleicht stärker, als es nötig ist, meint Graf. Sein Modell würde die Presse weiterhin unantastbar lassen, den Strafverfolgern aber zumindest begrenzte Möglichkeiten gegen Quellen geben. Der Burgermeister-Fall bei Inside-Justiz zeigt, dass es in der Praxis schon heute zu Konflikten kommt – und dass Vertrauen in die Medienfreiheit nicht nur von Gesetzen, sondern auch von deren Anwendung abhängt. Wer am Schutz schrauben will, muss jedoch drei Dinge garantieren: einen eng umrissenen Deliktskatalog, strikte richterliche Kontrolle und klare Schranken zugunsten von Whistleblowern. Ohne solche Vorkehrungen riskieren wir, das Fundament der Demokratie auszuhöhlen.
Quellenschutz im Überblick
- 17 BV: Medienfreiheit, Redaktionsgeheimnis.
- 172 StPO: Zeugnisverweigerungsrecht, Ausnahmen nur bei schwersten Delikten.
- 264 Abs. 1 lit. c StPO: Beschlagnahmeverbot für journalistische Unterlagen, „ungeachtet des Ortes“.
Problem: Dieser «ortsunabhängige Schutz» macht Strafverfolgung von Leaks fast unmöglich – der Kern von Grafs Kritik.


Wenn man am falschen Pfeiler sägt
Quellenschutz ist kein romantisches Berufsprivileg, sondern eine tragende Säule der Demokratie. Wer daran schraubt, rüttelt nicht an einer Detailfrage, sondern am Fundament der öffentlichen Kontrolle. Der Vorschlag von Staatsanwalt Damian K. Graf, den Quellenschutz räumlich zu beschneiden, gibt vor, eine technische Lücke zu schliessen. In Wahrheit verschiebt er das Machtgleichgewicht zugunsten der Strafverfolgung – und trifft ausgerechnet jene, die Missstände sichtbar machen sollen.
Graf diagnostiziert ein echtes Problem: Strafnormen zu Amts- und Geschäftsgeheimnissen laufen in der Praxis oft ins Leere, weil das Beschlagnahmeverbot für journalistische Unterlagen „ungeachtet des Ortes“ gilt. Ermittler kommen an die Quelle nicht heran, Beweise fehlen, Verfahren werden eingestellt. Sein Rezept: Der Schutz soll nur noch innerhalb der „journalistischen Sphäre“ gelten – bei Redaktionen und Medienschaffenden. Liegen Unterlagen bei der Quelle, soll der Staat zugreifen dürfen. Formal bleiben Journalistinnen und Journalisten unangetastet, faktisch wird aber genau jenes Versprechen ausgehöhlt, auf das sich Whistleblower verlassen müssen.
Das Problem beginnt beim Kernbegriff von Grafs Modell: Wo genau verläuft 2025 die Grenze der „journalistischen Sphäre“? In einer Medienrealität mit Homeoffice, Cloud-Speichern, Kollaborationstools, freien Mitarbeitenden und dezentralen Teams ist der Gewahrsam an Daten kein statischer Ort mehr, sondern ein Netz von Zugriffsrechten. Ist die verschlüsselte Kopie eines Dossiers auf dem privaten Laptop der Quelle Teil der journalistischen Kommunikation oder nicht? Was ist mit geteilten Ordnern, gemeinsamen Pads, Signal-Chats? Die scheinbar klare räumliche Trennlinie entpuppt sich als juristische Fiktion – und genau in diesen Grauzonen entscheidet dann das Ermessen der Staatsanwaltschaft.
Dass dieses Ermessen nicht stets medienfreundlich ausgeübt wird, zeigen die jüngsten Fälle in der Schweiz. Im Verfahren gegen Inside-Justiz versuchte ein St. Galler Staatsanwalt, mittels Editionsverfügung auf Korrespondenz und IP-Daten einer Redaktion zuzugreifen, um einen anonymen, beleidigenden Online-Kommentar zu identifizieren. Offiziell war das Redaktionsgeheimnis angeblich nicht tangiert, faktisch zielte der Eingriff mitten in die Vertrauenssphäre zwischen Medium und Publikum. Wenn es schon bei einer Bagatelle – einem Kommentar – zu solchen Schritten kommt, wie weit würden Strafverfolger gehen, sobald ihnen das Gesetz den Zugriff auf Quellenunterlagen explizit öffnet?
Hier liegt der eigentliche politische Gehalt von Grafs Vorstoss: Er verschiebt die Schwelle, ab der sich Behörden zur Jagd auf Whistleblower legitimiert sehen. Schon die abstrakte Möglichkeit, dass Polizei und Staatsanwaltschaft beim Informanten klingeln, genügt, um potenzielle Hinweisgeber abzuschrecken. Wer in einer Behörde, einer Bank oder einem Spital auf gravierende Missstände stösst, rechnet kühl durch: Riskiere ich ein Strafverfahren, eine Hausdurchsuchung, die Vernichtung meiner beruflichen Existenz? Oder schlucke ich den Skandal herunter und hoffe, dass es „irgendwie gut kommt“? Der gewünschte Nebeneffekt der Strafverfolgung – Abschreckung – trifft dann nicht die Täter, sondern diejenigen, die sie überhaupt erst ans Licht bringen könnten.
Besonders schief wird die Konstruktion im Zusammenspiel mit dem Bankgeheimnis. Art. 47 BankG kriminalisiert Journalistinnen, Journalisten und Dritte, wenn sie zugespielte Bankdaten veröffentlichen – unabhängig davon, wie gross das öffentliche Interesse an der Aufdeckung von Geldwäscherei, Steuerhinterziehung oder Korruption ist. Seit der Verschärfung 2015 drohen bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe. In dieser Lage nun ausgerechnet bei den Quellen den Schutz zurückzufahren, heisst: Die Schweiz belässt die Strafdrohung gegen Medienschaffende und schwächt gleichzeitig das letzte Schutzschild für Informanten. Wer im Finanzsektor Missstände offenlegen will, steht damit strafrechtlich völlig nackt da. Das ist nicht Rechtsstaat, das ist Systemerhalt mit Strafandrohung.
Graf verweist gerne auf Deutschland als Vorbild. Doch der Verweis greift zu kurz. Erstens ist der deutsche Quellenschutz eingebettet in eine gefestigte Rechtsprechung (Cicero-Entscheid des Bundesverfassungsgerichts), die staatliche Eingriffe massiv einhegt und die Folgen von Durchsuchungen bei Medien sehr genau gewichtet. Zweitens kennt die EU einen verbindlichen Whistleblower-Schutzrahmen, der Hinweisgeber in bestimmten Konstellationen ausdrücklich schützt. Die Schweiz hingegen steht 2025 ohne allgemeines Whistleblower-Gesetz da, bei gleichzeitiger Kriminalisierung der Bankberichterstattung. Wer in dieser Konstellation selektiv einen Baustein aus Art. 264 StPO herausbricht, importiert nicht das „deutsche Modell“, sondern transplantiert ein Element aus einem anderen System in einen schweizerischen Sonderbau, der längst unter Schieflage leidet.
Die eigentliche Schlüsselfrage lautet: Muss jede Strafnorm um jeden Preis durchsetzbar sein – selbst wenn dies die demokratische Kontrollfunktion der Medien schwächt? Rechtsstaat bedeutet nicht, dass jede Norm maximal exekutierbar sein muss. Rechtsstaat bedeutet auch, dass der Staat seine Macht bewusst begrenzt, wo höherrangige Schutzgüter – etwa Pressefreiheit und Quellenschutz – auf dem Spiel stehen. Es ist kein Zufall, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte den Quellenschutz als „cornerstone“ der Medienfreiheit bezeichnet und Durchbrechungen nur in äussersten Ausnahmefällen akzeptiert. Eine generelle „Effizienzkorrektur“ zugunsten der Strafverfolgung steht dazu quer.
Wer wirklich an einer ehrlichen Balance interessiert ist, müsste an ganz anderen Punkten ansetzen als Graf: an einem klaren, materiellen Whistleblower-Schutz, der Hinweisgeber bei gravierenden Missständen rechtfertigt oder entschuldigt; an einer Interessenabwägung im Bankengesetz, die das öffentliche Interesse an Aufklärung gegen das Geheimhaltungsinteresse stellt; an einer Präzisierung des Deliktskatalogs, bei dem Quellenschutz durchbrochen werden darf – eng, transparent, mit hoher richterlicher Hürde. Und nicht zuletzt an einer Kultur der Zurückhaltung in den Staatsanwaltschaften, wenn es um Eingriffe in die Medienfreiheit geht.
Grafs Vorstoss macht das Gegenteil: Er verspricht der Strafverfolgung mehr Biss, indem er die Zähne bei den Falschen ansetzt. Er adressiert die Frustration von Ermittlern, aber nicht die strukturellen Widersprüche der Schweizer Rechtslage. Und er setzt darauf, dass das Vertrauen in den Quellenschutz stabil bleibt, während man genau daran sägt. Das ist eine gefährliche Wette.
Denn Vertrauen ist in diesem Feld keine akademische Kategorie, sondern eine Binärgrösse: Entweder Quellen glauben, dass ihre Identität geschützt ist – oder sie reden nicht. Eine Reform, die dieses Vertrauen auch nur graduell erodiert, mag strafprozessual attraktiv erscheinen. Demokratietheoretisch aber ist sie ein schlechtes Geschäft. Grafs Eingriff wäre kein chirurgischer Feinschliff, sondern ein Schnitt in die Sicherheitsnetze der Öffentlichkeit. Wer ihn fordert, sollte ehrlich sagen: Mehr Effizienz für die Strafverfolgung bezahlen wir mit weniger Licht in den dunklen Ecken des Staates und der Wirtschaft.
Roger Huber
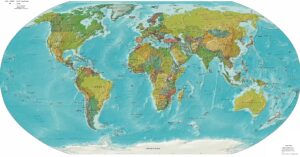
Internationaler Vergleich –
Skandinavien macht es vor
Im europäischen Vergleich zeigt sich, wie besonders die Schweizer Situation ist. In Deutschland geniessen Journalisten ein starkes Zeugnisverweigerungsrecht, das Beschlagnahmeverbot gilt jedoch nur im journalistischen Gewahrsam. Frankreich erlaubt Eingriffe nur bei einem „überragenden öffentlichen Interesse“, hat aber immer wieder Probleme mit der Praxis von Metadatenauswertungen. Spanien kennt verfassungsrechtlichen Quellenschutz, präzisiert aber erst jetzt durch ein neues Gesetz die Ausnahmen. Italien schützt die Identität von Quellen, erlaubt aber gerichtliche Durchbrechungen. Österreich geht weit, indem es ein ausdrückliches Umgehungsverbot verankert hat. In Skandinavien und Finnland gilt Quellenschutz sogar als Pflicht – ein Verstoss dagegen ist strafbar. Im Vergleich dazu steht die Schweiz ganz am oberen Ende: ortsunabhängig absoluter Schutz, kombiniert mit dem paradoxen Sonderfall des Bankgeheimnisses.
Schweiz
Rechtsgrundlagen: Art. 17 BV (Medienfreiheit, Redaktionsgeheimnis); StPO Art. 172 (Zeugnisverweigerungsrecht für Medienschaffende) und Art. 264 Abs. 1 lit. c (Beschlagnahmeverbot «ungeachtet des Ortes»).
Reichweite: Sehr hoch; Schutz gilt nicht nur für klassische Redaktorinnen, sondern auch für redaktionsnahe Personen. Unterlagen aus journalistischem Verkehr sind beschlagnahmefest.
Ausnahmen: Nur bei eng umschriebenen Schwerstdelikten; Amts- und Geschäftsgeheimnisverletzungen gehören ausdrücklich nicht dazu.
Praxis/Kasuistik: BGE 140 IV 108 (2014) – Quellenschutz gilt auch am Ort der Quelle selbst (prägender Leitentscheid). «Corona-Leaks» (2025) – Bundesgericht blockiert Entsiegelung, Quellenschutz vor Aufklärung; Verfahren später eingestellt.
Kurzurteil: Schweizer Maximalschutz – international am oberen Ende; genau dort setzt Grafs Reformidee (räumliche Begrenzung) an.
Deutschland
Rechtsgrundlagen: Art. 5 GG (Pressefreiheit); StPO § 53 (Zeugnisverweigerungsrecht für Berufsgeheimnisträger inkl. Journalist:innen), § 97 (Beschlagnahmeverbot nur für Unterlagen im Gewahrsam des Berufsgeheimnisträgers).
Reichweite: Stark, aber sphärengebunden – kein “Mitwandern” des Schutzes zu Drittorten.
Ausnahmen: Gerichtliche Abwägung im Einzelfall; der Beschlagnahmeschutz greift primär innerhalb der journalistischen Sphäre.
Praxis/Kasuistik: BVerfG «Cicero» (2007) – Durchsuchung beim Magazin Cicero als verfassungswidrig gerügt; betont die hohen Hürden für Ermittlungszugriffe bei Medien.
Kurzurteil: Vorbild für Grafs skizziertes Modell – Quellenschutz ja, aber räumlich begrenzt.
Frankreich
Rechtsgrundlagen: Loi n2010-1 vom 4. Januar 2010 (Quellenschutzgesetz), umgesetzt u. a. in Art. 2 des Pressegesetzes von 1881, flankiert durch Strafprozessvorschriften (CPP Art. 56-2, 60-1, 100-5, 326). Kernaussage: Eingriffe nur bei «impératif prépondérant d’intérêt public» (überragendes öffentliches Interesse), strikt notwendig und verhältnismässig; keine Pflicht zur Quellenoffenlegung.
Reichweite: Hoch, aber stets von einer gerichtlichen Güterabwägung abhängig.
Praxis/Kasuistik: EGMR «Ressiot et autres ./. France» (2012) – Hausdurchsuchungen bei L’Équipe und dessen Journalisten als unverhältnismässig verurteilt (Verletzung von Art. 10 EMRK). Debatten um die Auswertung von Telefon- und Metadaten («fadettes») zeigen allerdings Spannungen zwischen Gesetz und Praxis.
Kurzurteil: Starker, kodifizierter Schutz mit besonders hohen Hürden für staatliche Eingriffe.
Spanien
Rechtsgrundlagen: Verfassung Art. 20.1(d) (Pressefreiheit und Berufsgeheimnis der Journalisten). De jure bisher vor allem verfassungsrechtlicher Schutz; im Oktober 2025 wurde jedoch ein neues Organgesetz zum Quellenschutz verabschiedet, das Ausnahmen eng umreisst (nur bei unmittelbarer Gefahr für Leben, Sicherheit oder fundamentale Staatsinteressen) und Beschlagnahmen/Überwachung ausserhalb schwerster Delikte verbietet.
Reichweite: De jure verfassungsstark, de facto bislang eine Ermessens- und Abwägungslösung; das neue Gesetz schafft deutlich klarere, EMRK-konforme Schutzstandards ähnlich wie in Frankreich und Deutschland.
Praxis/Kasuistik: 2025 führte die Enthüllung von Ermittlungen gegen Justiz-Reporter zu einer Chilling-Effect-Debatte und beschleunigte die Gesetzesreform.
Kurzurteil: Im Wandel – auf dem Weg von einer vagen Abwägungslösung zu einem klar normierten Quellenschutz.
Italien
Rechtsgrundlagen: Costituzione Art. 21 (Meinungs- und Pressefreiheit); Codice di procedura penale Art. 200 (Berufsgeheimnis – umfasst auch Journalisten hinsichtlich der Identität ihrer Quellen; richterliche Durchbrechung möglich), flankiert von Art. 256 c.p.p. (Beschlagnahmeregeln).
Reichweite: Solider Schutz, aber nicht absolut; das Gesetz schützt v. a. die Identität von Quellen, erlaubt jedoch in Ausnahmefällen einen richterlichen Zugriff.
Praxis/Kasuistik: Gerichte verlangen eine strenge Notwendigkeits- und Verhältnismässigkeitsprüfung; in der Praxis wird je nach Fall unterschiedlich entschieden.
Kurzurteil: Mittel- bis hoher Schutz, gerichtszentriert – weniger weitreichend als in der Schweiz oder Skandinavien.
Österreich
Rechtsgrundlagen: Mediengesetz § 31 (Redaktionsgeheimnis) und StPO § 144 (Umgehungsverbot).
Reichweite: Sehr hoch; das Gesetz verbietet ausdrücklich, das Redaktionsgeheimnis durch Umwege auszuhebeln (Umgehungsverbot).
Ausnahmen: Nur in wenigen, besonders schwerwiegenden Fällen; grundsätzlich bleiben journalistische Quellen umfassend geschützt.
Praxis: Konfliktfälle sind selten; die Regeln gelten als wirksam und werden von den Behörden meist respektiert.
Kurzurteil: Äusserst starker Quellenschutz, der – dank Umgehungsverbot – auch gegen indirekte Ermittlungsansätze abgesichert ist.
Grossbritannien
Kein absoluter Quellenschutz. Contempt of Court Act 1981, Section10: Journalisten dürfen ihre Quellen geheim halten, ausser wenn ein Gericht entscheidet, dass eine Offenlegung “im Interesse der Justiz, der nationalen Sicherheit oder zur Verhinderung von Kriminalität” notwendig ist. Gerichte haben das mehrfach genutzt, um Quellen preiszugeben, aber meist nur in gravierenden Fällen. Der EGMR (Goodwin ./. UK, 1996) rügte Grossbritannien, nachdem ein Journalist zur Offenlegung einer Quelle gezwungen worden war – seither wird dieses Mittel sehr zurückhaltend eingesetzt.
Kurzurteil: In der Praxis besteht ein starker Schutz, doch gerichtliche Ausnahmen sind möglich und nicht so eng gefasst wie in der Schweiz.
Kanada
Kein allgemeines “Shield Law”, sondern richterrechtlicher Quellenschutz casuistisch entwickelt. Wegweisend waren Urteile wie R. v. National Post (2010) und R. v. Vice Media (2018): Der Supreme Court entschied, dass Quellenschutz nicht absolut ist, sondern eine Abwägung verlangt – öffentliches Interesse am Schutz der Quelle vs. Interesse der Justiz an Aufklärung. 2017 erliess das Parlament den Journalistic Sources Protection Act, der den Schutz stärkt: Polizei und Justiz benötigen nun eine richterliche Genehmigung und müssen beweisen, dass es keine zumutbare Alternative zur Preisgabe gibt.
Kurzurteil: Starker Schutz, aber immer abwägungsabhängig – kein absolutes Privileg wie in der Schweiz.
USA
Kein einheitlicher Bundes-Quellenschutz. Auf Bundesebene ist bisher jeder umfassende Shield Law-Entwurf gescheitert. In über 40 Bundesstaaten gibt es allerdings eigene Schutzgesetze mit teils sehr starkem Quellenschutz (z. B. New York, Kalifornien). Auf Bundesebene haben Gerichte wiederholt Journalisten zur Preisgabe von Quellen gezwungen (etwa im Fall Judith Miller / CIA-Leak 2005). Der Supreme Court (Branzburg v. Hayes, 1972) entschied, dass Journalisten vor einer Grand Jury kein absolutes Zeugnisverweigerungsrecht haben.
Kurzurteil: Ein Flickenteppich – auf Ebene der Bundesstaaten meist starker Schutz, auf Bundesebene schwach.
Japan
Gesetzlich verankerter Quellenschutz. Art. 4 des Newspaper Law und Art. 149 der Strafprozessordnung geben Journalisten ein Zeugnisverweigerungsrecht in Bezug auf ihre Quellen. Dieser Schutz gilt allerdings relativ: Gerichte können in Ausnahmefällen die Offenlegung anordnen, wenn sie als “unumgänglich” eingestuft wird. In der Praxis verteidigen Journalisten ihre Quellen meist erfolgreich, doch die Justiz hat einen beträchtlichen Ermessensspielraum.
Kurzurteil: Ein vorhandener, aber nicht absoluter Schutz – stärker von Gerichtsentscheiden abhängig als in der Schweiz.
Skandinavien
Sehr starker Quellenschutz in Schweden, Norwegen und Dänemark. In Schweden ist er Teil der Verfassung (Tryckfrihetsförordningen, Pressefreiheitsgesetz): Quellen haben ein Recht auf Anonymität, und Journalisten eine Pflicht, dieses zu wahren – ein Verstoss dagegen ist strafbar. Staatliche Stellen dürfen die Identität von Quellen nicht nachforschen; nur wenige Ausnahmen (z. B. bei schwerster Gefährdung der nationalen Sicherheit) sind vorgesehen. Norwegen gewährt im Media Liability Act ebenfalls ein weitgehendes Quellenschutzrecht; richterliche Eingriffe sind dort nur bei sehr gravierenden Verbrechen erlaubt. Dänemark bietet ähnlichen Schutz, wenn auch etwas weniger absolut; Gerichte können hier eine Offenlegung verlangen, wenn das öffentliche Interesse deutlich überwiegt.
Kurzurteil: Schweden bildet die Weltspitze beim Quellenschutz, Norwegen und Dänemark liegen ebenfalls sehr hoch – deutlich über Ländern wie Grossbritannien oder Kanada.
Finnland
Sehr starker Schutz, vergleichbar mit Schweden. Die Verfassung (Section 12) garantiert die Freiheit der Meinungsäusserung und damit auch den Quellenschutz. Journalisten haben ein nahezu absolutes Recht, ihre Informanten geheim zu halten, ausser bei “äusserst gewichtigen Straftaten” (z. B. Terrorismus). In der Praxis greifen die Behörden äusserst selten ein. Kurzurteil: Neben Schweden gilt Finnland als Benchmark-Land für Quellenschutz – ein internationales Vorbild an Konsequenz.