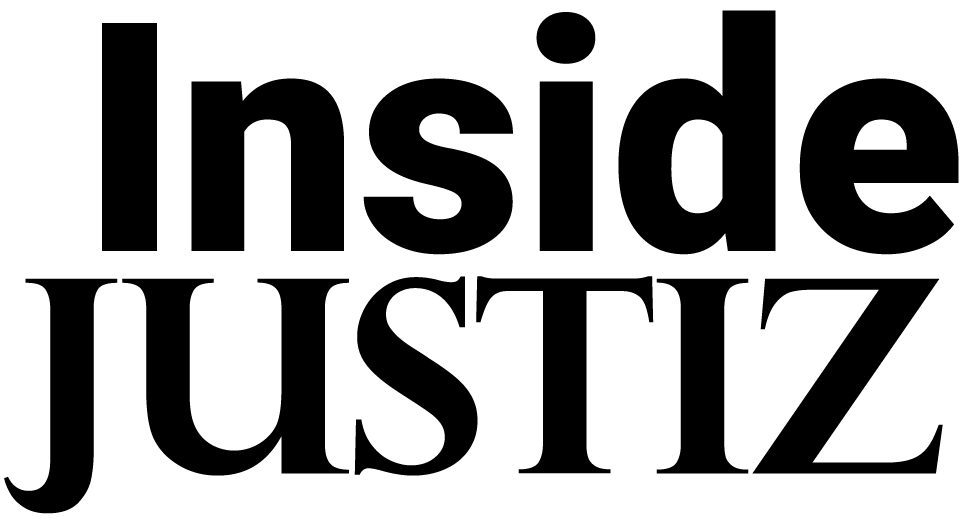Die Berner Richterin Franziska Luginbühl verbietet der WELTWOCHE und dem Medienblog ZACKBUM.CH, über ein laufendes Justizverfahren zu berichten. Hintergrund ist eine Klage des Historikers Bernhard C. Schär, der an der Universität Lausanne Geschichte lehrt und gegen die beiden Medienhäuser eine Klage wegen Persönlichkeits-verletzung führt. Das berichtet das Online-Portal INSIDE PARADEPLATZ.
Lorenzo Winter und Roger Huber
Der an der Universität Lausanne lehrende Historiker, der für seine postkolonialen Theorien bekannt ist, sah sich offenbar durch mehrere kritische Artikel in seiner Persönlichkeit verletzt. Die kritischen Beiträge der beiden erwähnten Medien hatten eine Studie von Schär zu den Zürcher «Mohrenkopf»-Inschriften zum Thema. Die Medienartikel hatten Schärs Gutachten als ideologisch gefärbt und methodisch mangelhaft kritisiert. WELTWOCHE und ZACKBUM.CH waren mit der Kritik allerdings nicht alleine.
Auch die NZZ setzte sich in zwei Artikeln kritisch mit der Arbeit Schärs auseinander. «Ist der Hausname ‘Zum Mohrenkopf’ wirklich ein Symbol für einen besiegten Schwarzen? Die Quellen sagen etwas anderes» übertitelte NZZ-Journalist Michael von Ledebur am 6. September seinen Artikel und berichtete, dass der Zürcher Heimatschutz ein eigenes Gutachten hatte erstellen lassen, das Schärs Arbeit grobe Fehler unterstelle. Am 12. September 2025 doppelte Rico Bandle im Feuilleton der NZZ nach und stellte die Frage, ob Schär in seinen Arbeiten Resultate zurechtbiege. Schär würden «schwere wissenschaftliche Fehler nachgewiesen – nicht zum ersten Mal», so die Unterzeile der NZZ. Der Artikel führte prompt zu einer Solidaritätsaktion von 29 anderen Wissenschafter von ETH und Universität Zürich, die der NZZ die «Diffamierung» der Person Schärs vorwarfen und sich für ihren Kollegen ins Zeug warfen. Zudem, so berichtete die NZZ selbst, hätten an anderer Stelle bereits 300 Forschende einen Appell für Schär unterzeichnet.
Diese Beiträge wurden dann von Journalist René Zeyer auf ZACKBUM.CH und in der WELTWOCHE in einer Reihe von Artikeln aufgegriffen, mit durchaus scharf und auch polemisch formulierter Kritik an Schär.
Klage am Berner Regionalgericht
Am 29. September 2025 reichte Schär nun gemäss INSIDE PARADEPLATZ Klage gegen Zeyer und die WELTWOCHE ein. INSIDE PARADEPLATZ ist ein anderes Medium, in dem Zeyer regelmässig publiziert. Schär liess über seine Anwältin Laura Kerstjens beantragen, dass mehrere Artikel sofort gelöscht werden müssten. Darunter die Artikel «Schär, der Schweiger» auf ZACKBUM.CH, «Der peinlichste Professor der Schweiz: Bernhard Carlos Schär hat ein 124-Seiten-Gutachten zur Entfernung des «Mohrs» geschrieben, ohne das Wort auch nur ein einziges Mal zu schreiben» (auf WELTWOCHE.CH und ZACKBUM.CH), «Wumms Bernhard C. Schär» (auf ZACKBUM.CH), «Schär der Schweiger» (auf ZACKBUM.CH) sowie «Mohr und kein Ende» (auf ZACKBUM.CH). Die Löschung müsse bis 24 Stunden nach Zustellung des Entscheids erfolgen. – Zum Redaktionsschluss dieses Beitrags scheint dies noch nicht der Fall gewesen zu sein, die Artikel waren über ihre direkten Links auf jeden Fall noch zugänglich.
Aufgegriffen vom WELTWOCHE und ZACKBUM.CH
Die Kritik in den NZZ-Artikeln werden in der Klageschrift zwar ebenfalls bestritten, gegen die «alte Tante» ist Schär offenbar aber nicht vorgegangen. Gegenstand der Klage sind lediglich die Artikel, die in der WELTWOCHE und auf ZACKBUM.CH erschienen sind und aus der Feder Zeyers stammen, der durchaus bekannt dafür ist, auch mal unter der Gürtellinie zuzuschlagen und vielen als ein «Enfant terrible» der Medienbranche erscheinen mag. Auch in der Polemik gegen Schär fand Zeyer für ihn gewohnt deutliche Worte, sprach etwa vom «peinlichsten Professor der Schweiz» oder nannte ihn eine «Schande für die Historikerzunft».
Die Klageschrift sieht darin und in weiteren Schmähungen eine unnötige Herabwürdigung. Aber nicht nur: Sie kritisiert auch den Tatsachengehalt der Berichte. So bestehe «kein Nachweis dafür, dass der Gesuchsteller Fehler gemacht habe». Und dass die Studie das Wort «Mohr» nicht verwendet habe, wie Zeyer schon im Titel schreibt, stimme ebenfalls nicht. Wörtlich aus der Klageschrift: «Die Behauptung, der Gesuchsteller habe ein 124-seitiges Gutachten verfasst, ohne das Wort «Mohr» ausgeschrieben zu haben, ist schlicht falsch.
lm wissenschaftlichen Bericht – es ist kein Gutachten, sondern eine in Auftrag gegebene Studie – ist das Wort bereits im Titel des Berichts ausgeschrieben. Es folgen mehr als 100 weitere Nennungen (vgl. bspw. Seite 11 des ETH-Berichts). Nur schon diese falsche Tatsachenbehauptung unterstreicht, dass der Autor dieses Artikels sich nicht einmal die Mühe machte, den von ihm thematisierten Bericht zu lesen. Oder aber er hat den Bericht bewusst ignoriert, was noch viel dreister ist.»
Stimmt das?
Richtig ist, dass die Autoren in der Schrift «Zürcher Mohren-Fantasien» – Eine Bau- und begriffsgeschichtliche Auslegeordnung ca. 1400 bis 2022» den Begriff Mohr in ihrem eigenen Text in der Variante «M***» schreiben. Richtig ist aber auch, dass sie diese Schreibweise inkonsistent verwenden, denn auf dem Titel der Arbeit ist der Name ausgeschrieben. An den anderen Orten, wo «Mohr» oder «Mohren» steht, handelt es sich dann allerdings immer um direkte Zitate, die nicht einfach aus woken Gedankengängen heraus abgeändert werden dürfen – das wäre tatsächlich wissenschaftlich nicht korrekt. Das gilt z.B. auch für die von der Rechtsanwältin angegebene Seite 11 des ETH-Berichts.
Wenn zwei das gleiche tun…
Zwischenfazit: Die Klageschrift wirft Zeyer vor, was sie selbst tut: Sie spitzt zu, ist undifferenziert und unterstellt unbelegte Sachverhalte – etwa, der Journalist habe die Studie gar nicht gelesen. Und greift in die Kommentierungsfreiheit der Medien ein. So spricht Zeyer beispielsweise von einem «Gefälligkeitsgutachten», das Schär abgeliefert habe. Die Klageschrift widerspricht, die Arbeit Schärs sei kein «Gefälligkeitsgutachten», sondern eine von der Stadt Zürich in Auftrag gegebene Studie, die mit einem wissenschaftlichen Bericht abgeschlossen wurde.»
Nur: Zeyers Wertung erscheint in diesem Punkt auch bei unvoreingenommener Betrachtung nicht von der Hand zu weisen, geht doch die Stadt Zürich als Auftraggeberin bereits davon aus, das Wort «Mohr» habe eine rassistische Wirkung. Ob dem so ist, ist freilich Gegenstand heftigster Debatten.
Auch sonst zielt Zeyer sehr wohl primär auf den inhaltlichen Gehalt von Schärs Arbeit und übt Kritik, die auch weniger von ihm selbst stammte, sondern die Standpunkte anderer wiedergab, wie sie auch in den NZZ-Beiträgen dargelegt worden waren. Darüber hinaus kritisierte Zeyer aber auch die Forscherinnen und Forscher, die sich gegen den kritischen NZZ-Artikel mit Schär solidarisiert hatten und rügte insbesondere, die Wissenschafter würden mit der plumpen Behauptung operieren, Schär würde von der NZZ persönlich diffamiert, statt dass sie sich inhaltlich der Kritik stellten, wie es sich im wissenschaftlichen Betrieb gehören würde.
Schockierende Zensuranträge durchgewunken
Besondere Brisanz entfalten dann die Anträge 7 und 8 von Schärs Rechtsanwältin Laura Kerstjens. Kerstjens verlangt dort zunächst, dass sowohl die WELTWOCHE wie ZACKBUM unter Androhung einer Geldstrafe von CHF 10’000 bis zum Abschluss des Verfahrens nicht mehr über Bernhard C. Schär berichten dürften – egal in welchem Zusammenhang. Und es kommt noch dicker: Auch über das vorliegende Verfahren ist beiden Medienhäuser jede Berichterstattung verboten.
Für kritische Medienrechtler sind das Zensuranträge, die in dieser Absolutheit weder mit Art. 10 der EMRK noch mit der Medienfreiheit nach Art. 17 BV vereinbar sind. Schockierend sei bereits der Antrag, findet einer, der nicht namentlich genannt werden möchte. – Die Anträge erstaunen umso mehr, als dass sie mit Rechtanwältin Kerstjens ausgerechnet von einer Anwältin gestellt werden, die am äussersten linken Rand der SP politisiert.
Kerstjens engagiert sich bei den «Demokratischen Jurist:innen Schweiz» und ist in Zofingen SP-Co-Präsidentin. Das frühere Juso-Mitglied kandidierte 2024 erfolglos als Grossratskandidatin im Kanton Aargau, aktuell steht sie auf der Kandidatenliste für den Zofinger Einwohnerrat. Ihr politisches Profil auf Smartvote könnte linker kaum sein.
Die Anträge Kerstjens überraschen deshalb, weil sich in der Vergangenheit die politische Linke auf politischer Ebene sich gegen schärfere Gesetze gegen die Medien gewehrt hatte. – Offenbar gilt das aber nur, solange die eigene Klientel nicht betroffen ist.
Für viele Beobachter genauso schockierend ist allerdings die Tatsache, dass die Anträge Kerstjens von der Gerichtspräsidentin der Zivilabteilung des Regionalgerichts Bern-Mittelland, der SVP-Richterin Franziska Luginbühl, nolens-volens durchgewunken wurde.
«Ob eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung vorliegt, darüber mag man vorliegend streiten», sagt eine Quelle gegenüber INSIDE JUSTIZ. «Dass aber per se jede Berichterstattung verboten wird, erscheint im Angesicht der Verfassungs- und Menschenrechtsgarantien schwer begründbar.»
Rechtliche Grundlagen
Superprovisorische Verfügungen, wie hier eine vorliegt, sind in der Schweiz nach Art. 265 ZPO bei besonderer Dringlichkeit möglich. Sie können nach Art. 265 Abs. 1 ZPO ex parte erfolgen, also ohne Gehör der Gegenseite. Der Gesetzgeber will damit rasche Eingriffe ermöglichen, z.B., wenn eine persönlichkeitsverletzende Berichterstattung unmittelbar bevorsteht und mittels superprovisorischer Verfügung noch verhindert werden kann.
Allerdings birgt sie erhebliche rechtsstaatliche Risiken, gerade weil sie sich allein auf die Darstellung des Gesuchstellers stützt. Auch dann ist aber das Gericht gehalten, eine summarische Prüfung der Anträge durchzuführen. Auch bezüglich der Dringlichkeit. Mehrere Autoren von juristischen Kommentaren schreiben dazu: «Die Gesuchstellerin muss diese Überdringlichkeit glaubhaft machen, wobei hier Glaubhaftigkeit nicht leichthin anzunehmen ist.» Karl Spühler ergänzt im ZPO Kurzkommentar: «Er hat nach Kenntnisnahme, dass er in einem Zeitungsartikel schwer in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird, sofort zu handeln.» Schon da stellen sich Fragen: Der erste gerügte Artikel war bereits 14 Tage vor dem Antrag erschienen.
Eine superprovisorische Verfügung gilt lediglich vorübergehend und bis zum Hauptverfahren, indem schliesslich auch ein Parteienwechsel stattfindet, um dann «in der Hauptsache» zu entscheiden, ob tatsächlich eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung vorliegt. Bei Medienartikeln ist die Widerrechtlichkeit in der Regel aufgehoben, wenn «ein überwiegendes öffentliches Interesse» besteht. Die Klageschrift verneint ein solches, insbesondere, was die ihrer Ansicht nach «unnötigen Herabwürdigungen» betrifft.
Sarkastische Kritik ist in Kauf zu nehmen
Die Zürcher Privatrechtsprofessorin Andrea Büchler bestätigt das im OFK zu dem betreffenden Art. 28 ZGB allerdings nur teilweise: «Werturteile stellen dann eine Verletzung der Persönlichkeit dar, wenn sie eine Person unnötig verletzen und beleidigen. Scharfe, sarkastische Kritik ist aber in Kauf zu nehmen, solange sie im gleichen sachlichen Rahmen bleibt wie die sie veranlassende Veröffentlichung» und verweist dabei auf BGE 126 III 305.
Letzterer Entscheid des Bundesgerichts hält klar fest, dass die Veröffentlichung unwahrer Tatsachen an sich widerrechtlich sei, «auch wenn nicht jede journalistische Unkorrektheit, Ungenauigkeit, Verallgemeinerung oder Verkürzung eine Berichterstattung insgesamt als unwahr erscheinen» liessen.
Und weiter: «Meinungsäusserungen, Kommentare und Werturteile sind zulässig, sofern sie auf Grund des Sachverhalts, auf den sie sich beziehen, als vertretbar erscheinen. Sie sind einer Wahrheitsprüfung nicht zugänglich. Soweit sie allerdings zugleich auch Tatsachenbehauptungen darstellen, wie es z.B. in einem sogenannten gemischten Werturteil der Fall ist, gelten für den Sachbehauptungskern der Aussage die gleichen Grundsätze wie für Tatsachenbehauptungen. Zudem können Werturteile und persönliche Meinungsäusserungen – selbst wenn sie auf wahrer Tatsachenbehauptung beruhen – ehrverletzend sein, sofern sie von der Form her eine unnötige Herabsetzung bedeuten.»
Experten wollen sich nicht festlegen
Von INSIDE JUSTIZ befragte Juristen tun sich im vorliegenden Fall schwer damit, sich festzulegen. Verschiedentlich ist zu hören, Schär müsse sich grundsätzlich Kritik gefallen lassen, aber ob in dem gewählten Ausmasse? Die Frage wird also darauf hinauslaufen, ob eine Bezeichnung wie «Schande für die Historikerzunft» als «unnötig herabsetzend» qualifiziert wird oder vom Gericht aufgrund des Sachverhalts als vertretbar eingestuft wird. Klar erscheint, dass Schär für letzteres tatsächlich wohl massive Verstösse gegen die wissenschaftliche Standards vorgeworfen werden können müssten.
Andere Quellen machen aber auch darauf aufmerksam, dass im politischen Umfeld eine härtere Gangart zu akzeptieren sei. Schär agierte vorliegend immerhin als Wissenschafter mit einem durch Steuergelder finanzierten Studienauftrag; aktuell arbeitet er als Professor an der Universität Lausanne mit Geldern des Nationalfons und wird damit vom Staat finanziert. Er ist damit zumindest eine relative Person des Zeitgeschehens. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) betont, dass Personen in öffentlicher Funktion scharfe Kritik hinnehmen müssen.
Das alles betrifft indes ausschliesslich die bereits publizierten Beiträge. Anders verhält es sich mit dem Verbot, über das hier vorliegende Verfahren überhaupt nur zu berichten. Präventive Zensur ist nach Art. 10 EMRK nur in extremen Ausnahmefällen zulässig, beispielsweise bei Aufrufen zu Gewalt oder massiven Eingriffen in die Intimsphäre. Dass die hier verfügte superprovisorische Massnahme im Punkt des Verbots der Berichterstattung rechtskonform gelten kann, erscheint mehr als fraglich.
* * *
Alarmsignal für Medienschaffende
Unbesehen von den betroffenen Medienschaffenden: Der vorliegende Fall ist ein medienethisches Alarmsignal. Dass man über einzelne Formulierungen in den inkriminierten Artikeln streiten kann? Kann man. Die Klage Schärs geht aber weiter über das hinaus und zeugt von einem seltsamen Verständnis sowohl von Wissenschaft wie auch von Medienfreiheit. Wenn ein Publikationsverbot beispielsweise damit begründet wird, die wissenschaftlichen Fehler Schärs seien «nicht nachgewiesen», dann verkennt diese Argumentation, dass der wissenschaftliche Diskurs und der Streit um die Gültigkeit von wissenschaftlicher Arbeit nachgerade die «sine qua non» von Wissenschaft bedeutet.
Dasselbe gilt, wenn gerügt wird, ein Artikel sei widerrechtlich persönlichkeitsverletzend, weil der Journalist wahrheitswidrig von einem Gutachten schreibt – statt einer Studie. Oder wenn er zum Schluss kommt, dass «Gutachten» sei ein «Gefälligkeitsgutachten», weil es – wenig überraschend – genau zu dem Schluss kommt, den die Auftraggeber sich unzweifelhaft wünschten.
Wenn die Berner Gerichtspräsidentin Franziska Luginbühl Anträge mit solchen Begründungen nolens volens durchwinkt, dann missbraucht sie ihr Amt. Das gilt insbesondere für das unter keinem Titel nachvollziehbare Verbot, über das anhängig gemachte Gerichtsverfahren überhaupt auch nur berichten zu dürfen. Eine solche Zensur kann man nicht anders denn als widerrechtlichen Verstoss sowohl gegen Art. 10 EMRK als auch gegen die Medienfreiheit aus Art. 19 der BV zu sehen.
Wichtig wäre nun eine deutliche Protestnote der gesammten Branche, insbesondere auch der Journalistenverbände. Nur: Davon ist nichts zu erkennen. Der Grund ist simpel: Zeyer hat sich zu viele Feinde geschaffen, als dass ihm heute jemand zu Hilfe eilen würde. Solidarität gibt nur für die, die «zum Kuchen» dazugehören.
Titelbild: Prof. Bernhard C. Schär (links) und Journalist René Zeyer (rechts)

Richterin Franziska Luginbühl Schönenberger
Franziska Luginbühl Schönenberger ist Gerichtspräsidentin (SVP, früher BDP) am Regionalgericht Bern-Mittelland. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Universität Bern (Master of Law) und erwarb das Anwaltspatent des Obergerichts Bern. In der Öffentlichkeit bekannt wurde sie durch mehrere Verfahren, in denen ihr Vorgehen von Anwälten und Medien als ungewöhnlich streng und teilweise willkürlich bezeichnet wurde.
In einem früheren Fall zeigte sie den Berner Anwalt Oliver Lücke wegen angeblichen Prozessbetrugs an – obwohl laut Recherchen verschiedener Medien entlastende Beweise bereits vorlagen. Der Fall sorgte in der Anwaltschaft für Irritation, weil der Vorwurf schliesslich nicht aufrechterhalten werden konnte.
Aktuell steht Luginbühl Schönenberger erneut in der Kritik, nachdem sie gegen die Weltwoche und den Journalisten René Zeyer eine sogenannte superprovisorische Verfügung – umgangssprachlich als «Maulkorb» bezeichnet – erlassen hat. Wie Inside Paradeplatz berichten, wird dieser Entscheid von mehreren Medienrechtlern als schwerwiegender Eingriff in die Pressefreiheit beurteilt. Juristen verweisen dabei auf die Europäische Menschenrechtskonvention (Art. 10 EMRK), die Eingriffe in die freie Meinungsäusserung nur in eng begrenzten Fällen zulässt.
In Fachkreisen gilt Luginbühl Schönenberger als Vertreterin einer Linie, die richterliche Autorität betont und Kritik an der Justiz als potenzielle Gefährdung ihrer Integrität betrachtet. Kritische Stimmen aus der Anwaltschaft und der Medienlandschaft sehen darin eine bedenkliche Tendenz, mit disziplinarischen und prozessualen Mitteln gegen missliebige Personen vorzugehen.
Ihr Name steht damit sinnbildlich für eine Justizkultur, in der sich die Grenzen zwischen richterlicher Unabhängigkeit und öffentlicher Kontrolle zunehmend verschieben – ein Thema, das weit über den Kanton Bern hinaus Fragen zur Balance zwischen Rechtsschutz, Transparenz und Pressefreiheit aufwirft.