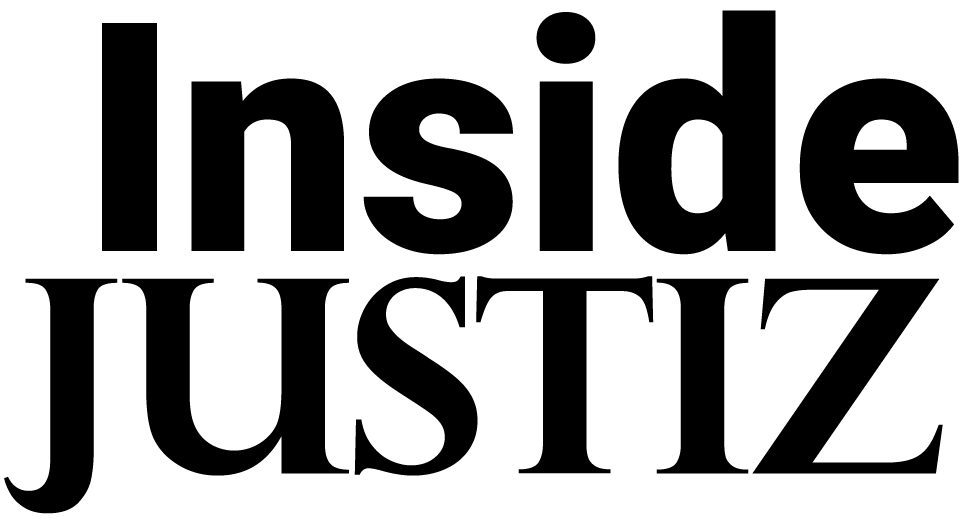Acht Jahre Verfahren, mehrere rechtskräftige Urteile – und dennoch politischer Widerstand: Der Einbürgerungsfall Talal Aldroubi ist längst kein Einzelfall mehr, sondern ein Stresstest für den Rechtsstaat. Erstmals nimmt nun der Anwalt von Talal Aldroubi ausführlich Stellung und ordnet den Fall juristisch ein. Im Interview erklärt er, warum es hier nicht um Integration, Sprache oder Schulden geht, sondern um eine grundsätzliche Frage: Wie verbindlich sind Gerichtsurteile, wenn Parlamente sie politisch nicht akzeptieren wollen?
Der Fall Talal Aldroubi beschäftigt den Kanton Thurgau seit bald acht Jahren. Was als ordentliche Einbürgerung begann, entwickelte sich zu einem exemplarischen Konflikt zwischen Politik und Justiz. In zwei ausführlichen Beiträgen hat Inside-Justiz den Fall bereits aufgearbeitet: Zuerst mit dem Artikel «Einbürgerung ist kein Gesinnungstest, sondern Rechtsanwendung», später mit der Analyse zur Frage, wo kantonale Autonomie endet und bundesgerichtliche Bindung beginnt.
Seit 2018 läuft das Einbürgerungsverfahren von Talal Aldroubi im Kanton Thurgau. Zuerst blockierte die Einbürgerungskommission Romanshorn, später verweigerte der Grosse Rat das Kantonsbürgerrecht mit 72 zu 42 Stimmen bei acht Enthaltungen. Spätestens mit dem Urteil des Bundesgerichts vom Oktober 2023 war der juristische Befund klar: Die Ablehnung des Gemeindebürgerrechts beruhte auf einer willkürlichen Gewichtung einzelner Kriterien. Dennoch verweigerte der Thurgauer Grosse Rat im Februar 2025 das Kantonsbürgerrecht erneut – trotz eidgenössischer Einbürgerungsbewilligung des Staatssekretariats für Migration. Erst das Verwaltungsgericht Thurgau stoppte diesen Entscheid am 10. September 2025 und wies das Parlament an, Aldroubi nach Erneuerung der Bundesbewilligung einzubürgern.
Wiederkehrende Vorwürfe
Im Zentrum der politischen Auseinandersetzung standen immer wieder dieselben Vorwürfe: Alimentenschulden in der Höhe von rund 11’500 Franken, eine angeblich ungünstige wirtschaftliche Prognose und ungenügende Deutschkenntnisse. Sämtliche dieser Punkte wurden von den Gerichten geprüft und verworfen. Das Bundesgericht qualifizierte diese Ablehnungsgründe 2023 als willkürlich; Romanshorn musste daraufhin das Gemeindebürgerrecht erteilen. Dennoch rollte die Thurgauer Justizkommission das Dossier nochmals auf – und das Parlament sagte erneut Nein, obwohl das Staatssekretariat für Migration (SEM) im Mai 2024 die eidgenössische Einbürgerungsbewilligung erteilt hatte. Das Verwaltungsgericht Thurgau hob den Parlamentsbeschluss am 10. September 2025 auf und wies den Grossen Rat an, Aldroubi nach Erneuerung der Bundesbewilligung einzubürgern. Dennoch wurden sie politisch erneut aufgegriffen – zuletzt sogar mit neuen formalen Argumenten zum Zeitpunkt des Sprachnachweises.
Im folgenden Interview ordnet der Weinfelder Rechtsanwalt Dr. Andreas Brauchli und Vertreter von Talal Aldroubi, den Fall aus juristischer Sicht ein. Er erklärt, weshalb es hier nicht um individuelle Integrationsdefizite geht, sondern um eine Grundsatzfrage des Rechtsstaats: Was geschieht, wenn politische Gremien beginnen, rechtskräftige Gerichtsurteile als unverbindliche Meinungsäusserungen zu behandeln? Und welche Folgen hat es für das System, wenn ein Parlament seine Rolle als rechtsanwendende Instanz verkennt? Das Interview knüpft an die bisherigen Recherchen von Inside-Justiz an (Thurgau: Keine Einbürgerung trotz Bundesgerichtsurteil, 2024) und Der Fall Talal Aldroubi: Wenn die Politik die Gewaltenteilung als Ausrede missbraucht, 2025) – und vertieft jene Punkte, an denen der Konflikt zwischen Rechtsanwendung und politischem Machtanspruch offen zutage tritt.
«Hier wird nicht die Grenze eines Gesuchstellers getestet, sondern die des Systems»
Herr Brauchli, warum geben Sie in diesem Fall ein Interview – und warum gerade jetzt?
Andreas Brauchli: Weil dieser Fall eine Grenze testet. Nicht die Grenze von Herrn Aldroubi, sondern die Grenze des Systems: Wie verbindlich ist ein rechtskräftiges Urteil, wenn ein Parlament politisch anderer Meinung ist? Das Verwaltungsgericht hat den Grossen Rat angewiesen, das Kantonsbürgerrecht zu erteilen. Wenn nun gewisse Kantonsräte behaupten, Gerichte könnten dem Parlament «keine Anweisungen geben», verkennen diese wesentliche Grundsätze unseres Rechtsstaates.
Der Fall ist inzwischen auch Thema in der nationalen Berichterstattung, etwa bei SRF. Ist das aus Ihrer Sicht Zufall – oder braucht es heute medialen Druck, damit rechtsstaatliche Selbstverständlichkeiten wieder ernst genommen werden?
Ich arbeite als Anwalt und bin nicht auf die Unterstützung durch Medien angewiesen. Gerichtsentscheide allein müssten eigentlich genügen. Die Realität ist aber leider oft eine andere. Öffentlichkeit ersetzt zwar kein Recht – aber sie wird manchmal nötig, wenn staatliche Akteure beginnen, rechtsstaatliche Bindungen zu relativieren. Dass dieser Fall nationale Aufmerksamkeit erhielt, ist wohl kaum ein Zeichen von Sensationslust, sondern war eher ein Symptom dafür, dass hier etwas grundlegend schiefläuft.
Was ist der juristische Kern dieses Falls in einem Satz?
Auch Entscheide über Einbürgerungen sind rechtsstaatlich nach Verfassung und Gesetz zu fällen und durch übergeordnete Gerichtsinstanzen überprüfbar; sie sind weder nach Parteigesinnung zu fällen noch als Gnadenakte zu verstehen.
Gegner argumentieren: «Ein Ratsmitglied kann man nicht zwingen, so zu stimmen.» Ist das nicht richtig?
Als Satz ist das bequem, weil er die eigentliche Frage umgeht. Natürlich zwingt niemand ein Ratsmitglied, den Arm zu heben. Aber auch ein Parlament in seiner Funktion als erste Instanz in einem Rechtsverfahren darf nicht willkürlich entscheiden. Entsprechend der im Thurgau gewählten Rechtsordnung – andere Kantone haben die Kompetenzen sinnvoller geregelt – hatte der Grosse Rat hier als erste Instanz zu entscheiden, mit ordentlicher Weiterzugsmöglichkeit an das Verwaltungsgericht (§ 40 Abs. 5 KV, § 54 Abs. 3 VRG). Ein solcher Parlamentsbeschluss ist also nichts anderes als ein anfechtbarer Entscheid. Wenn er rechtswidrig ist, muss er von der Rechtsmittelinstanz aufgehoben werden – genau dafür gibt es Rechtsmittel. Das Verwaltungsgericht hat den Beschluss des Grossen Rates aufgehoben und ihm als unterer Instanz klare Anweisungen erteilt.
In der politischen Debatte heisst es oft pauschal: «Das Parlament hat entschieden.» Geht dabei nicht unter, dass Verantwortung nicht anonym ist, sondern von konkreten Mehrheiten getragen wird?
Diese Frage stellte sich hier nicht. Es ging nicht um eine politische Debatte, sondern um einen erstinstanzlichen Entscheid über die Erteilung des Kantonsbürgerrechts. Der Grosse Rat hatte nicht als Legislative zu beschliessen, sondern als untere Instanz in einem Rechtsverfahren. Dies scheint eine Mehrheit seiner Mitglieder nicht begriffen zu haben, obwohl der zuständige Regierungsrat noch vor der Beschlussfassung warnend auf diese besondere, in der Kantonsverfassung so festgelegte Funktion des Parlaments hingewiesen hatte. Wenn das Verwaltungsgericht den unrechtmässigen Entscheid hernach aufhob, war das kein Angriff auf die Demokratie, sondern bloss die rechtsstaatlich vorgesehene Korrektur eines gesetzwidrigen Entscheids.

Hermann Lei (Bild ) behauptete ausserdem, das Verwaltungsgericht habe das Prinzip der Gewaltentrennung missachtet. Was sagen Sie dazu?
Ich bin höchst erstaunt, dass ein Jurist und Kantonsrat derartigen Unsinn redet und offensichtlich nicht einmal die Gesetze seines eigenen Kantons kennt. Denn dass hier überhaupt der Grosse Rat entscheiden musste, ist in § 40 Abs. 5 KV leider so systemwidrig vorgesehen. Wenn man also wollte, wäre höchstens festzustellen, dass das Prinzip der Gewaltenteilung durch die Kantonsverfassung verletzt wird, indem sie beim Kantonsbürgerrecht die Kompetenz zur Fällung eines anfechtbaren Entscheides der Legislative zuweist. Im Übrigen sollte sich Hermann Lei vielleicht einmal überlegen, wie es mit der Gewaltentrennung zu vereinbaren ist, wenn er als Mitglied der Legislative laufend Urteile der Judikative (Bundesgericht, Verwaltungsgericht) kritisiert.
Ein weiterer Vorwurf lautet: «Sprachtest nicht bestanden.» Was ist die Realität?
Ein einzelnes Modul – Lesen B1 – wurde einmal knapp nicht bestanden, im nächsten Anlauf aber problemlos nachgeholt. Am 1. März 2019 erwarb mein Mandant sogar das Sprachdiplom B2. Den Vorwurf der angeblich ungenügenden Sprachkenntnisse hat das Bundesgericht schon im Oktober 2023 ausführlich widerlegt. Das Verwaltungsgericht bestätigte kürzlich erneut die (bei Weitem) genügenden Kenntnisse der deutschen Sprache. Das Bundesgericht liess übrigens die Frage offen, ob die hohen sprachlichen Anforderungen im Thurgau überhaupt bundesrechtskonform sind. Ich wäre nicht überrascht, wenn es diese Frage bei nächster Gelegenheit verneinen würde.
Ist Sprache im Einbürgerungsdiskurs nicht längst ein politischer Marker geworden?
Ja. Sprache funktioniert politisch als Symbol. Juristisch muss sie messbar, konsistent und verhältnismässig bewertet werden. Nach erteilter Bundesbewilligung und ohne neue Tatsachen längst rechtskräftig widerlegte Behauptungen wieder hervorzuholen, ist rechtlich nicht haltbar. Ergänzt sei übrigens, dass mein Mandant das notwendige Sprachniveau sogar noch in einer zweiten Landessprache (Französisch) erfüllen würde, was wohl die wenigsten Mitglieder des Grossen Rates von sich behaupten könnten.
Was bedeutet das Urteil des Verwaltungsgerichts konkret?
Es bedeutet, dass der Parlamentsbeschluss vom 19. Februar 2025 rechtswidrig war. Er wurde aufgehoben, und das Gericht hat angeordnet, nach Erneuerung der Bundesbewilligung das Kantonsbürgerrecht zu erteilen. Das ist keine Empfehlung, sondern eine verbindliche Anweisung. Der Grosse Rat hat nach erneuerter Bewilligung des Bundes gar keine andere Wahl, als das Kantonsbürgerrecht zu erteilen. Es handelt sich um ein klassisches Rückweisungsverfahren, in welchem die untere Instanz an die Weisung der Rechtsmittelinstanz gebunden ist. Mit § 54 Abs. 3 VRG hat der Grosse Rat dies selbst so bestimmt.
Warum braucht es eine Erneuerung der Bundesbewilligung?
Weil die eidgenössische Bewilligung zeitlich auf ein Jahr befristet ist und seit einer Gesetzesänderung nicht mehr verlängert werden kann. Sie ist hier wegen der Verzögerung durch Justizkommission und Parlament abgelaufen, während das Beschwerdeverfahren beim Verwaltungsgericht noch hängig war. Nur darum konnte das Verwaltungsgericht das Kantonsbürgerrecht nicht gleich selbst erteilen. Der durch die rechtswidrige Trotzreaktion des Grossen Rates verursachte Schaden besteht also in zusätzlichen Verfahrensschlaufen, zusätzlichem Aufwand für alle Beteiligten, zusätzlichen Belastungen für meinen Mandanten und vor allem auch in massiven Zusatzkosten zulasten der Steuerzahler.
In diesem Einbürgerungsfall mussten Kanton und Gemeinde bis heute allein schon Parteientschädigungen im Betrag von 35’690 Franken bezahlen! Die Gerichtskosten, der Aufwand aller sonstigen Behörden und Ämter und des Grossen Rates mitsamt seinen Kommissionen sind dabei noch nicht berücksichtigt. Die seit acht Jahren andauernde „Trötzelei“ der Behörden kostete also die Steuerzahler bereits weit mehr als 100’000 Franken – bloss weil meinem Mandanten seit ebenso langer Zeit vorgeworfen wird, er hätte eine Schuld von 11’500 Franken noch nicht bezahlt, die er nach klarer Abmachung mit der betreffenden Gemeinde auch noch gar nicht bezahlen muss.
Ihr Mandant sagt, besonders belastend sei gewesen, dass sich ausserhalb der Gerichte kaum jemand öffentlich schützend vor ihn gestellt habe – auch aus Parteien, die sich sonst auf Rechtsstaat und Minderheitenschutz berufen. Ist Schweigen juristisch neutral?
Juristisch vielleicht. Politisch sicher nicht. Schweigen stabilisiert bestehende Mehrheiten. Es ermöglicht, dass einzelne Akteure den Ton setzen und Narrative prägen. Gerade in sensiblen Verfahren wie Einbürgerungen hat dieses Schweigen Wirkung – auch wenn es formell korrekt sein mag.
In der Berichterstattung ist von einer «Kraftprobe» die Rede. Ist das nicht überzeichnet?
Nein. Der Begriff trifft es. Es ist eine Machtfrage, weil sich hier eine laute Mehrheit ganz bewusst über verfassungsmässige Grundregeln und über das eidgenössische Bürgerrechtsgesetz hinwegsetzte, um ihr politisches Süppchen zu kochen.
Rechnen Sie mit einem zweiten Nein des Grossen Rats?
Ich hoffe nicht. Spielraum besteht keiner. Bei einem erneuten Nein würde das Verwaltungsgericht das Kantonsbürgerrecht mit Sicherheit direkt erteilen, mit weiteren Kosten für den Kanton und mit dem Effekt, dass der Thurgauer Grosse Rat erneut gesamtschweizerisch negative Schlagzeilen machen würde. Ein solcher Glaubwürdigkeitsverlust wäre für den ganzen Kanton fatal.
Was macht dieser Fall mit Ihrem Mandanten?
Er zermürbt. Es ist eine jahrelange Wiederholung derselben unnötigen Scheindebatten. Ein Rechtsstaat sollte solche Endlosschlaufen vermeiden, vor allem auch aus Respekt vor der eigenen Ordnung.
Titelbild: Talal Aldroubi

Schweigen als Machtfaktor
Der Fall Talal Aldroubi wird in der Öffentlichkeit oft als Konflikt zwischen einem Gesuchsteller und einer restriktiven rechten Politik gelesen.
Diese Verkürzung greift jedoch zu kurz. Tatsächlich offenbart das Verfahren ein strukturelles Problem, das weit über parteipolitische Lager hinausgeht: politische Verantwortungslosigkeit durch Schweigen.
Zwar stemmten sich SVP und EDU offen gegen die Einbürgerung, obwohl es klare Bundesgerichts- und Verwaltungsgerichtsurteile gab. Doch dieses Vorgehen wurde auch deshalb möglich, weil andere Parteien ihre Rolle nicht wahrnahmen.
Weder von der SP noch von den Grünen kam eine sichtbare, geschlossene Intervention, die öffentlich klarstellte: Der Entscheid des Grossen Rates ist rechtswidrig und muss korrigiert werden.
Intern wird zwar Empathie geäussert, Verständnis signalisiert und vereinzelt auch Kritik an der Mehrheitsentscheidung formuliert. Doch politisch blieb das folgenlos. Dieses Schweigen ist nicht neutral. Es stabilisiert Mehrheiten, ermöglicht Narrative und verschiebt Verantwortung ins Ungefähre. Am Ende heisst es dann: „Der Grosse Rat hat entschieden.” Dass diese Entscheidung von konkreten Personen getragen wurde – und von anderen bewusst nicht bekämpft –, gerät dabei aus dem Blick.
Besonders problematisch ist das in Einbürgerungsverfahren. Denn hierbei geht es nicht um politische Gestaltungsfreiheit, sondern um gebundene Rechtsanwendung. Spätestens mit der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung und den klaren Leitplanken von Art. 14 BüG ist der politische Spielraum minimal. Wer sich dennoch wegduckt, überlässt das Feld jenen, die Einbürgerung weiterhin als Gesinnungs- oder Tugendtest verstehen.
Der Fall Aldroubi zeigt deshalb auch ein Defizit linker und liberaler Politik: Rechtsstaatlichkeit wird gerne beschworen, aber zu selten verteidigt, wenn sie unpopulär ist oder keinen unmittelbaren politischen Gewinn verspricht. Stattdessen verlässt man sich auf die Gerichte und normalisiert damit implizit den Rechtsbruch als legitime politische Etappe.
Gerichte sind jedoch kein Ersatz für Politik. Sie sind die Notbremse, wenn staatliche Organe ihre Bindung an Recht und Verfassung vergessen. Wer das hinnimmt, statt frühzeitig klar Position zu beziehen, trägt Mitverantwortung für die Erosion rechtsstaatlicher Selbstverständlichkeiten.
Der Fall ist somit kein Einzelfall, sondern ein Warnsignal: Der Rechtsstaat scheitert nicht nur an seinen offenen Gegnern, sondern auch an denen, die schweigen, wenn er verteidigt werden müsste.