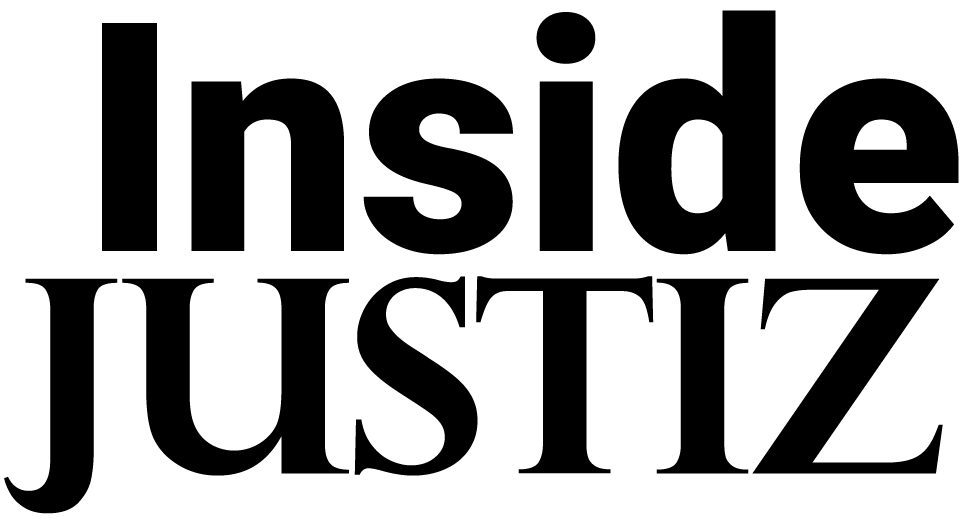Gelesen in einer hellen Polarnacht vor Spitzbergen, schlägt dieses Buch wie kalter Wind ins Gesicht: sauber geschrieben, akkurat, nachvollziehbar — und dennoch aufwühlend. Hermann Lei rekonstruiert die Hildebrand-Affäre nicht als verbeulter Medienmythos, sondern als Kaskade institutioneller Aussetzer, politischer Manöver und persönlicher Eitelkeiten. Wer danach noch meint, die Schweiz sei damals krisenfest gewesen, hat ein anderes Buch in der Hand.
Der Band ist kompakt (ca. 150 Seiten), präzise gebaut und entlang eines straffen Zeitstrahls erzählt. Leitend sind Protokoll-Schnipsel, Mails, Aktennotizen und Erinnerungen; das verleiht dem Text Geradlinigkeit und Prüfbarkeit. Besonders stark geraten die Anfangskapitel: Leis Prolog schildert die 6-Uhr-Hausdurchsuchung am Freitag, dem 13. Januar 2012, mit beklemmenden Details — vom Durchsuchungsbefehl über beschlagnahmte Geräte bis zur Fahrt nach Zürich. Das liest sich hart, aber nie theatralisch; es bildet den Ton für das, was folgt: ein Staat, der beim kleinsten Stein ins Rollen gleich den Fels ins Tal schickt.
Inhaltlich arbeitet Lei minutiös die Dollar-Transaktion(en) auf dem Konto des damaligen SNB-Präsidenten Philipp Hildebrand durch, die in den Tagen massiver Frankenstärke liefen. E-Mails und Banknotizen belegen, wie der betreuende Banker Felix Scheuber auf ein Vermögensverwaltungs-Mandat drängte, Hildebrand aber aktiv über eigene Schritte diskutierte — inklusive der heiklen Frage, ob und wie die Transaktion intern zu melden sei. Der Folgetag: SNB-Massnahmen schwächen den Franken, der Dollar zieht an. Die Chronologie sitzt — und sie ist brisant.
Figuren und Rollen
Ich war damals (u.a. als Medienexperte) nah an der Debatte dran. Umso mehr überrascht mich die klare Zeichnung einzelner Rollen:
- Philipp Hildebrand (ehemaliger SNB-Präsident): Das Buch zeichnet ihn als blendend vernetzten Taktierer mit frappant flexiblem Verhältnis zur ganzen Wahrheit. Ob man jedes Adjektiv teilt, ist zweitrangig: Die dokumentierte Sequenz — private Transaktion, anschliessende SNB-Entscheide, spätere Kommunikation — bleibt erklärungsbedürftig. Dass bereits die GPK 2013 die bundesrätliche Improvisation kritisierte (ad personam-Auftrag an die EFK, verspätete Information des Gesamtbundesrats), stützt den Eindruck eines unsauberen Settings auf höchster Ebene.
- Christoph Blocher (ehemaliger Bundesrat SVP): Sein Vorgehen ist — in dieser Darstellung — nachvollziehbar. Er suchte die diskrete Klärung via Bundespräsidentin, nicht den Knall via Medien. Dass der Staat ihn später so unfreundlich behandelte (bis zur Hausdurchsuchung), wirkt mindestens befremdlich. Die Chronik vermerkt den 20. März 2012 explizit als „Hausdurchsuchung bei Christoph Blocher – potenziell beweisrelevant“. Aus Sicht der Rechtsstaatlichkeit ein fragwürdiger Zugriff mit magerem Ertrag.
- Micheline Calmy-Rey (SP) und Eveline Widmer-Schlumpf (BDP) (ehemalige Bundesrätinnen): Das Buch zeichnet die Übergabe von Hinweisen an die damalige Bundespräsidentin sowie die später dominierende Rolle Widmer-Schlumpfs nach. Die GPK rügte nachträglich, dass der Bundesrat ohne Rechtsgrundlage in Belange der SNB eingriff und zu spät als Kollegium informiert wurde. Politisch mag manches verständlich sein, rechtlich war es dünn.
- Claudio Schmid (SVP-Kantonsrat): Er taucht als früher Ansprechpartner des Informatikers („Roman N.“) und als kritischer Begleiter auf — inklusive der nüchternen Feststellung, dass ein Strafbarkeitsnachweis wegen Insiderdelikten wohl nicht gelinge, die Sache aber politisch/moralisch schwer wiegt.
Mein Fazit zur Figurenzeichnung: Viele agierten klug-kurzsichtig. Man schloss Deutungslücken mit Macht, nicht mit Transparenz. Das nervt beim Lesen — und es erklärt, wieso das Vertrauen so schnell erodierte.
Medien — die besten Freunde der Wahrheit?
Lei hält den Medien kein Hofkonzert. Er zeigt, wie einzelne Redaktionen zum Teil mit dem «Informatiker» paktieren, andere das Narrativ der Gegenseite verstärken, wieder andere die Empörung routiniert bewirtschaften. «Der Blick paktiert mit Roman N.» nennt es ein Kapitel; an anderer Stelle geht es um die SRF-«Arena» und den Nachrichtendienst, anderswo um die Rolle der Weltwoche. Der Eindruck: weniger vierte Gewalt als vierte Front. Für eine Demokratie ist das beides — normal und gefährlich. Beispiele aus dem Buch sind ausreichend konkret, um den Vorwurf zu stützen, dass Teile der Branche sich bereitwillig ins Spiel nehmen liessen.
Wer whistleblowt, riskiert in der Schweiz zu viel — diese Erkenntnis durchzieht das Buch wie ein roter Faden. Die polizeilich orchestrierte Wucht gegen Lei ist dokumentiert; die späteren Verfahren gegen ihn und andere Beteiligte ebenfalls. Besonders bemerkenswert: Das Obergericht Zürich hielt fest, dass eine interne Meldung an die Compliance der Bank «kaum erfolgversprechend» gewesen wäre. Das ist ein juristischer Satz mit politischer Sprengkraft: Er sagt viel über gelebte Kultur.
Rund um den Buchlaunch eskalierte der Konflikt erneut. Blick berichtete im Februar 2025 über die Festnahme des damaligen IT-Spezialisten Reto T., der sich «zum Schweigen gebracht» fühlte; eine Episode, die in der Öffentlichkeit als Druckkulisse wahrgenommen wurde. (Blick) In Deinem Dossier findet sich zudem die Darstellung, dass es im Kontext der Veröffentlichung zu einer polizeilichen Einweisung aus psychischer Belastung gekommen sei — als weiterer Baustein in einer Abschreckungsspirale gegenüber Hinweisgebern. Diese Vorwürfe sind nicht gerichtlich geklärt, illustrieren aber das Klima, in dem dieses Buch landet.
Mein Eindruck: Die Schweiz hat seit Jahren kein überzeugendes, vertrauenswürdiges Whistleblowing-System. Das Buch hält uns diesen Spiegel gnadenlos vor.
.. und doch bleibt ein Restgeruch
Formell zog die SNB Konsequenzen: Bereits im Jahr 2012 passte der Bankrat die Regeln zu Eigengeschäften an; die einschlägigen Passagen in den Jahresberichten dokumentieren die Sondersitzungen im Januar/Februar «in connection with the private financial transactions by the Hildebrand family» und die Revision der Own-Account-Regelungen. Das ist die korrekte Lehre auf der Regelwerk-Ebene. Aber sie kam erst nach dem öffentlichen Crash — zu spät, um das Vertrauen ex ante zu schützen.
Leis Darstellung wirkt hier wie ein Scheinwerfer: Selbst perfekt gegossene Regeln helfen nichts, wenn Kultur und Führung schwächeln — oder wenn Spitzenpersonal glaubt, mit guter Rhetorik komme man schadlos durch.
Brücke in die Gegenwart
Dieses Buch ist mehr als Rückschau; es ist ein Test auf Gegenwartsfähigkeit. Der aktuelle Wirtschaftsdruck (inkl. der neuen US-Zollkonflikte) fordert die Bundesverwaltung erneut. Und wieder gewinnt man den Eindruck, der Bund plane zu wenig in Szenarien und renne Ereignissen hinterher. Die Parallele ist unbequem: Damals improvisierte man bei der SNB-Affäre im engen Kreis; heute droht man, bei Handels- und Souveränitätsfragen denselben Fehler des zu späten, zu reaktiven Handelns zu wiederholen.
Gehört zur Fairness: Es gab Anpassungen — in der SNB-Compliance, im politisch-administrativen Bewusstsein für Interessenkonflikte. Aber das reicht nicht, solange nicht Führung, Kultur, Systeme auf Krisenfestigkeit getrimmt sind. Ein paar handfeste Lehren für morgen:
- Mandat & Metriken: Wer politische oder para-staatliche Schlüsselrollen innehat, braucht harte No-Go-Zonen für private Finanzgeschäfte, verpflichtende Pre-Clearance und periodische Audits.
- Krisen-Gremien fix statt ad hoc: Ein kerniges Krisenkabinett mit klarer Rechtsgrundlage, Zugriff auf Datenräume und definierter Kommunikationshoheit.
- One-Voice & Dokumentation: Jede relevante Entscheidung mit Zeitstempel, Begründung, Abweichungen.
- Whistleblower-Schutz professionalisieren: Orientierung an ISO 37002 (Whistleblowing-Management), neutrale Meldestellen, externe Ombudsstellen, Verbot von Retorsion — und echte Rehabilitation, nicht nur Präventionsfolien.
- Medienbeziehung mit Kühlkopf: Keine Kungelei, keine Dämonisierung. Proaktive, belegte Kommunikation statt Lagerbildung. Das Buch zeigt, wie gefährlich beides ist.
Und die Frage nach Charakter
Man kann Krisenmanagement perfektionieren — es ersetzt keinen Charakter. Leis Buch ist auch ein Porträt von Persönlichkeiten, deren Eitelkeit (und teils Zynismus) die beste Organisation aushebeln kann. Die Lügengebilde entstehen dort, wo Mandatsträger glauben, Regeln gälten vor allem für die anderen. Genau deshalb braucht es robuste Systeme, die Charakterschwächen antizipieren und Schaden eindämmen.
Bewertung des Buchs:
- Stärken: Klarer Aufbau, quellennahe Erzählweise, eindringliche Szenen (Hausdurchsuchung, Bundesbern-Tage), präzise Rekonstruktion der Bank- und Politikprozesse. Saubere Sprache, keine Effekthascherei.
- Blinde Flecken: Es bleibt naturgemäss Leis Sicht. Wo Dritte widersprechen (z. B. Bewertung einzelner Motive), wünschte man sich teils zusätzliche Fremdstimmen.
- Relevanz: Hoch — als Zeitdokument, als Mahnung zur Krisenfestigkeit und als Lehrbuchfall für Whistleblowing-Kultur in der Schweiz.
DER AUTOR:
Hermann Lei ist Rechtsanwalt und SVP-Politiker aus dem Thurgau. Bekannt wurde er landesweit als zentrale Figur der Hildebrand-Affäre, in der er als Hinweisgeber auf heikle private Devisengeschäfte des damaligen SNB-Präsidenten aufmerksam machte. Das Zürcher Obergericht würdigte 2017 seinen Gang zur «Weltwoche» ausdrücklich als legales Whistleblowing und reduzierte die Strafe markant — ein seltener Präzedenzfall für den Schutz berechtigter Interessen. Lei sitzt seit Jahren im Thurgauer Kantonsrat und präsidiert heute die SVP-Fraktion. Beruflich führt er ein Advokaturbüro in Weinfelden.
Bestelloptionen für das Buch
Titel: Blocher, Hildebrand und Widmer-Schlumpf
Autor: Hermann Lei
Verlag: Edition Königstuhl
Erscheinungsjahr: 2025
ISBN: 978-3-907339-90-9
Preis: CHF 25.00
Direktbestellung: im Verlagsshop von Edition Königstuhl (Online-Bestellung)
Buchhandel: unter Angabe der ISBN in jeder Buchhandlung bestellbar.
Titelbild: Bildmontage: (links oben) Micheline Calmy-Rey, (unten links) Hermann Lei, (Mitte oben) Philipp Hildebrand, (unten rechts) Christoph Blocher, (oben rechts) Claudio Schmid, (Mitte rechts) Eveline Widmer-Schlumpf
In Krisen zeigt sich Charakter: Die unbequeme Bilanz zur Affäre
Dieses Buch hat mich mehrfach überrascht und oft irritiert. Irritiert über Menschen, die sich wichtiger nahmen als ihr Mandat. Über Medien, die sich bereitwillig instrumentalisieren liessen. Und über einen Staat, der bei Alarm lieber diskret taktiert, statt entschlossen zu handeln. Gelesen in einer hellen Polarnacht vor Spitzbergen wirkt diese Geschichte wie ein harter Nordwind: klärend, aber kalt. Wer verstehen will, warum wir in Krisen oft verlieren, bevor sie beginnen, sollte dieses Buch lesen.
Vor allem zeigt es eine unbequeme Wahrheit: In Krisen zählt Charakter. Nicht Sonntagsreden, sondern Demut, Pflichtethos, Wahrhaftigkeit, Selbstdisziplin – und die Bereitschaft zur Rechenschaft. Genau daran fehlte es vielen Entscheidungsträgern in dieser Affäre. Beim damaligen SNB-Präsidenten fiel die Mischung aus rhetorischer Eleganz und praktischer Flexibilität auf. Sie verknüpfte private Interessen und öffentliche Verantwortung auf gefährliche Weise. In der politischen Führung dominierte das Taktische über das Grundsätzliche: Es wurde improvisiert statt geführt, geredet statt aufgeklärt. Medien schwankten zwischen Jagdtrieb und Lagerdenken – zu selten diente die Dramaturgie der Wahrheitsfindung.
Die Behandlung von Christoph Blocher bleibt symptomatisch. Man muss seine Politik nicht mögen, um festzustellen: Die Art, wie der Staat ihn als ehemaligen Justizminister behandelte, war befremdlich – ja, unfair und mies. Der Zugriff wirkte weniger wie kontrollierte Rechtsanwendung und mehr wie eine Machtdemonstration. Das wirft eine Frage auf, die bleibt: Was wäre geschehen, wenn Blocher nicht Blocher gewesen wäre? Hätten dieselben Mittel und dieselbe öffentliche Widerstandskraft existiert? Ein Rechtsstaat muss so handeln, dass solche Fragen gar nicht entstehen.
Besonders düster ist das Bild beim Whistleblowing. Wer Missstände meldete, wurde eingeschüchtert, pathologisiert oder öffentlich vorgeführt. Das Signal reicht weit über den Fall hinaus: Schweigen lohnt sich. Auch das ist Charakter – der einer Organisation, die Loyalität mit blinder Gefolgschaft verwechselt. Wer die DIN 22361, den internationalen Standard für Krisenmanagement, ernst nimmt, weiss: Ohne geschützte Hinweisgeberkanäle, klare Rollen, strikte Interessenkonfliktregeln und eine „One-Voice-Policy“, die Wahrheit vor Bequemlichkeit stellt, bleibt jedes Krisenhandbuch ein Feigenblatt.
Diese Affäre prüfte beides: Systeme und Menschen. Das System offenbarte Konstruktionsfehler – unklare Zuständigkeiten, fehlende Szenarienplanung, schwache Compliance. Die Menschen zeigten Lücken im Charakter: Egos vor Ämtern, Taktik vor Transparenz, Kalkül vor Verantwortung. Regeln lassen sich nachschärfen; Kultur und Haltung müssen vorgelebt werden. Genau dort hapert es bis heute. Man spürt es erneut, wenn der Bund in neuen Konflikten zu spät und zu zögerlich reagiert: Die Werkzeuge werden besser, doch der Wille, sie früh, offen und konsequent einzusetzen, bleibt ungleich verteilt.
Vielleicht ist das die grösste Zumutung des Buches: Es zwingt uns, nicht nur Verfahren, sondern auch Personen zu kritisieren – mitsamt ihren blinden Flecken. Und es öffnet die Tür für reife Konsequenzen: Fehler einzugestehen, Strukturen zu reparieren, Hinweisgeber zu schützen und Führung stärker an Prinzipien statt an Personen zu orientieren.
Gute Krisenfähigkeit ist nicht, Lücken zu kaschieren – sondern die Stärke, sie auszuhalten und zu schliessen.
Roger Huber
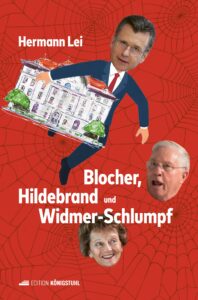
Krisenkommunikation — was uns DIN 22361 sagt
Der Fall ist ein Paradebeispiel für verfehlte Crisis Governance. Legen wir die DIN 22361 (Security & Resilience – Crisis Management – Guidelines) als Raster darüber, springen gleich mehrere Defizite ins Auge:
- Führung & Verantwortlichkeiten: Rollen und Mandate waren nicht sauber geklärt. Die politische Ad-hoc-„Aufsicht“ über die SNB war rechtlich fragil, operativ riskant. DIN fordert klare Zuständigkeiten, definierte Eskalationspfade und dokumentierte Entscheidlogs — genau das fehlte.
- Früherkennung & Lagebild: Ein offizielles Lagebild gab es erst spät und bruchstückhaft. DIN verlangt kontinuierliches Horizon Scanning und Situational Awareness auch für Reputationsrisiken von Mandatsträgern.
- Ethik & Interessenkonflikte: Hochrangige Funktionsträger brauchen robustere Conflict-of-Interest-Kontrollen (Pre-Clearance, Blackout-Perioden, Mandatslösungen). Das Regelwerk wurde erst nach dem Sturm nachgezogen.
- Krisenkommunikation: Wahr, schnell, einheitlich — und mit einem Minimum an Empathie. Stattdessen: scheibchenweise Wahrheiten, widersprüchliche Sprecherrollen, Leaks und Talkshow-Dramatik. DIN verlangt vorbereitete Playbooks, Sprecher-Disziplin und One-Voice-Policy.
- Schutz von Hinweisgebern: Ein zeitgemässer Krisenstandard bindet Speak-Up-Kanäle (intern/extern) ein, definiert Schutzmechanismen und verhindert Retorsion. Der reale Verlauf wirkte abschreckend.
- Recovery & Lernen: Die SNB passte zwar Regeln an; aber der breitere Staat nahm zu wenig mit. Die GPK-Kritik blieb folgenarm; ein verbindliches, ressortübergreifendes Krisenhandbuch mit Rollen, Fristen, Datenräumen und Audit-Trails hat sich bis heute nicht als Standard durchgesetzt.
Mit DIN 22361 als Massstab hätte die Schweiz 2011/12 anders entschieden, gesprochen, dokumentiert — und wahrscheinlich weniger Porzellan zerschlagen.