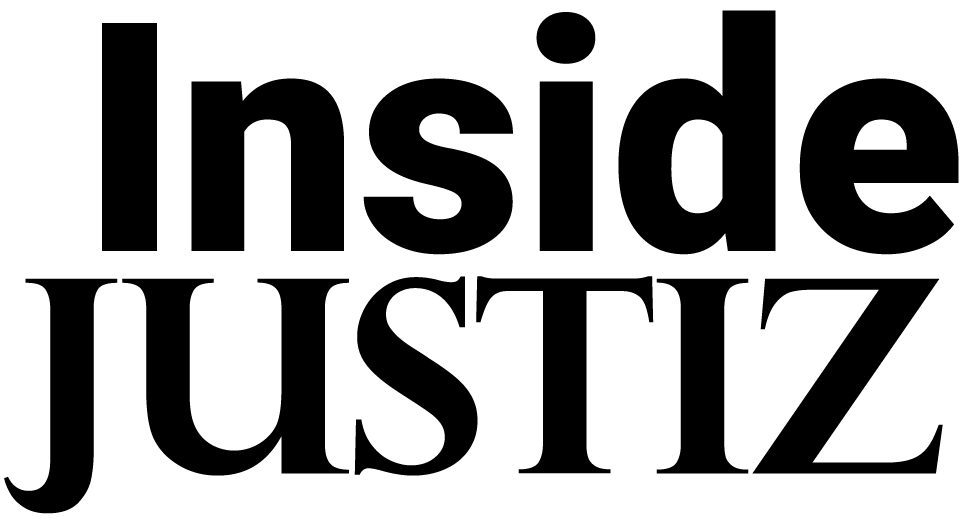Mittwoch dieser Woche wurde das 139-seitige schriftliche Urteil im dem Churer Vergewaltigungsfall zugestellt. Darin ist die ausführliche Begründung für die Verurteilung des ehemaligen Verwaltungsrichters zu finden. Der Verurteilte und die Staatsanwaltschaft hatten bereits vor Jahresfrist Berufung angemeldet. Ob sie diese nun aber auch durchziehen und innert der Frist von 20 Tagen eine Berufungserklärung einreichen, ist noch offen. Die Staatsanwaltschaft Graubünden teilte INSIDE JUSTIZ am Freitagabend mit, ein Entscheid darüber sei noch nicht gefallen. – Eine Anfrage beim Anwalt des Beschuldigten blieb ohne Antwort.
.
Der frühere Verwaltungsrichter war am 12. November 2024 nach einer zweitägigen Hauptverhandlung vor dem Regionalgericht Plessur verurteilt worden zu 23 Monaten Freiheitsstrafe, einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen à CHF 90.00 sowie zu einer Busse von CHF 2’300.– Davon tatsächlich bezahlen müsste er lediglich die Busse, die anderen Strafen wurden bedingt ausgesprochen.
Dazu kämen allerdings noch verschiedene weitere Kosten: Dem erstinstanzlich Verurteilten wurden die Untersuchungskosten der Staatsanwaltschaft im Umfang von CHF 23’201 ebenso aufgebrummt wie die Gerichtskosten von CHF 17’000 sowie die Kosten der vom Staat bestellten Rechtsanwältin des Opfers von total CHF 45’703. An das Opfer hätte er zudem eine Genugtuung von CHF 17’000 zu bezahlen sowie Schaden zu ersetzen im Umfang von CHF 3’626. Alles kämen also Kosten auf den Verurteilten zu von rund CHF 102’000 – zusätzlich zu den Kosten für seine eigene Verteidigung, und dafür hatte der Beschuldigte mit den Rechtsanwälten Martin Sünderhauf und Tanja Knodel ja gleich deren zwei engagiert.
Der Konjunktiv in der obigen Darstellung ist dabei dem Umstand geschuldet, dass mit einem Weiterzug an das Bündner Obergericht die nächsthöhere Instanz das Urteil gesamthaft oder in Teilen abändern könnte – und zwar sowohl zugunsten wie auch zulasten des Beschuldigten. Staatsanwaltschaft Graubünden und der Verurteilte haben zwar eine Berufung angemeldet, diese verfällt gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO allerdings, falls die Parteien nicht binnen 20 Tagen jetzt auch eine Berufungserklärung nachreichen, in der sie erklären, ob sie das Urteil als ganzes oder einzelne Teile davon angreifen.
Die angeklagten Taten
Dem Richter waren gemäss Anklageschrift konkret drei Tatkomplexe vorgeworfen worden. Der schwerwiegendste Vorwurf betraf einen Vorfall am 13. Dezember 2021. Der Richter hatte am Abend die Praktikantin zu einer Fallbesprechung bei sich im Büro empfangen, wo er dann versuchte, intim zu werden, indem er z.B. versuchte, ihre Brust zu küssen und sie im Schritt berührte und dazu masturbierte. Als die Praktikantin ihm zu verstehen gegeben hatte, dass sie das nicht wolle und versuchte, den Raum zu verlassen, hatte der Richter ihr den Ausgang versperrt, sie an die Wand gedrückt, ihre Hände festgehalten, sie geleckt und den Geschlechtsverkehr vollzogen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass es sich bei diesen letzeren Handlungen um eine Vergewaltigung nach Art. 190 Abs. 1 StGB gehandelt hatte.
Schon vier Tage zuvor hatte der ehemalige Verwaltungsrichter und frühere CVP-Politiker zudem versucht, der Praktikantin Intimitäten abzunötigen. Z.B. küsste er sie auf den Hals, versuchte, ihr den Nacken zu massieren. Die Praktikantin hatte ihm jedes Mal zu verstehen gegeben, dass das nicht gehe und ihn weggestossen. Das Gericht qualifizierte diese Handlungen wie auch die Handlungen am 13.12. vor der eigentlichen Vergewaltigung zwar nicht als sexuelle Nötigungen, aber als tätliche sexuelle Belästigungen.
Freigesprochen wurde der ehemalige Verwaltungsrichter vom Vorwurf der sexuellen Belästigung im Bezug auf den Chatverkehr mit der Praktikantin. Er hatte ihr über längere Zeit und mehrfach anzügliche Chat-Nachrichten geschickt wie «I WILL DI» oder ihr geschrieben, sie sei gefährlich und sie aufgefordert, Mut zu zeigen. Hiezu hielt das Gericht fest, dass es aufgrund der Reaktionen der Praktikantin, die stets versucht hatte, den Vorgesetzten nicht gegen sich aufzubringen, «erhebliche und unüberwindbare Zweifel» daran gebe, dass es dem Beschuldigten bewusst gewesen sein musste, dass die Praktikantin sich durch seine Nachrichten belästigt gefühlt hatte. Er wurde deshalb in diesem Anklagepunkt freigesprochen.
Darstellung des Opfers glaubwürdiger
In der Beweiswürdigung schätzte das Gericht die Aussagen des Opfers als glaubwürdiger ein und argumentiert über mehrere Seiten des Urteils, wie es zu diesem Schluss kommt. Ein Beispiel für die Argumentation der Richter Flütsch, Schwendener und Saluz: «Sie schilderte auch ihre Emotionen im Verlaufe des Vorfalles eindrücklich und überzeugend, so dass sie fürchtete, Gerüchte zu starten, wenn sie zu lange im Büro des Beschuldigten bleiben würde und dass sie sich darüber gefreut habe, dass der Beschuldigte für sie Tee zubereitete. Ihren Unglauben, als der Beschuldigte sie körperlich anging und überwältigte, ihren Ekel, als sie ihn sich befriedigen sah, dass sie es lächerlich fand, als sie dachte, er wolle sie umstimmen, als er ihr den Weg aus seinem
Büro abschnitt, ihre Unsicherheit, ihre Angst und ihre Verzweiflung, aber auch ihre vordergründig angesichts der Situation fast absurd wirkende, aber durch die Umstände und die Vorgeschichte durchaus nachvollziehbare Frustration, dass es trotz aller Versuche, ihr Praktikum erfolgreich abzuschliessen, nun doch zu so einem Vorfall gekommen war, wirken überzeugend und stimmig.»
Die Einwände der Verteidigung räumt das Gericht Punkt für Punkt aus.
Interesse an der Begründung des Strafmasses
Während das Strafmass schon bei der mündlichen Urteilseröffnung am November 2024 bekannt wurde, warteten Fachleute und Laien mit Interesse auf die ausführliche Begründung. Dass der Beschuldigte zwar der Vergewaltigung schuldig gesprochen wurde, aber lediglich eine bedingte Freiheitsstrafe von 23 Monaten erhielt, sorgte schweizweit nicht nur in Leserbriefen, sondern auch unter Fachleuten für Kritik und Unverständnis. – Und beflügelte die Theorien derer, die vermuteten, dass die Richter hier einen Kollegen und Parteifreund über Massen geschont hatten.
In der schriftlichen Urteilsbegründung legen die Richter nun dar, wie sie zur Höhe der Strafe gelangen. Rechtliche Grundlage bilden Art. 47, Art. 48, Art. 49 und Art. 50 StGB sowie die vom Bundesgericht entwickelte Praxis der Strafzumessung, wie sie z.B. in BGE 136 IV 55 beschrieben ist. Dabei ist wichtig, dass in der Schweiz ein Verschuldensstrafrecht zur Anwendung kommt, kein Erfolgsstrafrecht.
Das bedeutet in der Praxis, dass für die Höhe der Strafe auf das Verschulden des Täters abgestellt wird, nicht auf den «Erfolg» der Tat. – Was in der Praxis dazu führt, dass für zwei Straftaten, die objektiv betrachtet identisch sind und z.B. in beiden Fällen zum Tod eines Opfers geführt haben (Juristen sprechen vom «Erfolg»), trotzdem zwei ganz verschiedene Strafen verhängt werden, weil die Schuld des Täters eben unterschiedlich beurteilt wird. Krasses Beispiel: Eine Person mit einer geistigen Beeinträchtigung muss womöglich für eine identische Tat nicht das gleiche Verschulden treffen wie den habilitierten Professor.
Das Gericht nimmt das schwerste der Delikte aus Ausgangspunkt, hier also die Vergewaltigung. Dazu beurteilt es die objektive Schwere der Tat und das subjektive Tatverschulden, die dafür ausschlaggebend sind, ob die «Einsatzstrafe» sich am oberen oder unteren Endes des Strafmasses bewegen soll. Das Strafmass für die Vergewaltigung beträgt Freiheitsstrafe zwischen 1 und 10 Jahren. Anschliessend werden Faktoren abgewogen, die für eine Verschärfung oder Verringerung der Strafe sprechen.
Leichte objektiveTatschwere?
Zur Tatschwere schreiben die Richter Flütsch, Schwendener und Saluz in Punkt 4.1 des Urteils wörtlich: «Zur objektiven Tatschwere ist auszuführen, dass der Beschuldigte seine Tat nicht von Anfang an geplant hatte, aber sich bewusst war, dass er und die Privatklägerin alleine im Gebäude waren, sie mithin keine Hilfe erwarten konnte, da er sich vorab vergewissert hatte, dass niemand sonst noch anwesend war, ehe er versuchte, sie zu verführen. Nachdem sie ihn abgewiesen hatte, wandte er nur leichte körperliche Gewalt an und verletzte sie nicht physisch, nutzte aber seine körperliche Überlegenheit klar aus, um die Privatklägerin zunächst am Verlassen seines Büros zu hindern und sodann dazu zu zwingen, den Geschlechtsverkehr über sich ergehen zu lassen. Dabei ignorierte er ihren verbalen und körperlichen Widerstand. Er benutzte dabei kein Kondom, was das Risiko einer Schwangerschaft und der potenziellen Übertragung von Geschlechtskrankheiten schuf.»
Und weiter: «Allerdings setzte er den Geschlechtsverkehr nicht bis zum Samenerguss fort, sondern hörte vorher auf, wobei die Privatklägerin ihn aber mehrmals dazu auffordern musste, nachdem er sie gefragt hatte, ob er aufhören solle, und er sich wiederholt vergewisserte, ob sie es auch wirklich wolle, was dies wieder
etwas relativiert. Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass er Verwaltungsrichter und damit gegenüber dem Opfer, welches Praktikantin war, eine starke Machtposition einnahm, und dass er trotz diesem Machtgefälle während längerer Zeit Druck auf die Privatklägerin ausgeübt hatte, um sie zu sexuellen Handlungen zu verleiten. Er penetrierte die Privatklägerin nicht nur mit seinem Penis, sondern auch mit seinen Fingern und leckte auch ihre Vulva, nahm damit also verschiedene, teils sehr intime Handlungen zur Verletzung ihrer sexuellen Integrität vor, die über das für den Geschlechtsverkehr nötige Minimum deutlich hinausgingen.»
Zur Überraschung mehrerer Juristen kommen die drei Richter zum Schluss, dass trotz aller dieser Faktoren «die objektive Tatschwere im Rahmen der Vergewaltigung als noch leicht zu beurteilen ist». Interessant auch: Zur Beurteilung der objektiven Schwere der Tat gehörten zumindest nach einem Teil der Lehre eigentlich auch Überlegungen dazu, welche Auswirkungen die Tat auf das Opfer hatte. – Dazu fehlen unter diesem Punkt allerdings konkrete Aussagen. An anderer Stelle des Urteils ist hingegen nachzulesen, dass die Praktikantin aus Scham und Angst vor dem Täter aus dem Kanton weggezogen war und bereits zwei Mal die Wohnung wechselte, weil der Täter ihre neue Wohnadresse aus den Verfahrensunterlagen erfahren – und sie ja dann prompt kurz vor ihrer Anwaltsprüfung auch noch bedroht hatte (wofür er ebenfalls verurteilt wurde).
Auch subjektiv nur leichtes Verschulden?
Ähnlich argumentieren die Richter Bettina Flütsch, Paul Schwendener und Hermi Saluz dann auch bei der subjektiven Tatschwere. Aufgrund der grossen Bedeutung an dieser Stelle wiederum der volle Abschnitt wörtlich aus dem Urteil: «Bei der subjektiven Tatschwere ist zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte sich zum Zeitpunkt, als er sich entschied, Gewalt gegen die Privatklägerin anzuwenden, um seinen Willen durchzusetzen, genau bewusst war, dass sie das Büro verlassen wollte, da sie dies sowohl verbal angekündigt hatte als auch im Begriff war, zur Türe zu gehen, mithin ihr Wille, keine sexuellen Handlungen mit ihm vorzunehmen oder über sich ergehen zu lassen, klar und unmissverständlich zum Ausdruck gebracht hatte. Dass sie sich vor diesem Vorfall im Chatverkehr etwas ambivalent oder teilweise flirtend verhalten hatte, wirkt sich nicht zu seinen Gunsten aus. Selbst wenn eine sexuelle Beziehung zwischen ihm und der Privatklägerin bestanden hätte, würde sich das nicht verschuldensmindernd auswirken. Er handelte mit direktem Vorsatz, als er ihren Widerstand brach. Dabei war er auf die reine Befriedigung seiner Lust aus.»
Nur: Trotz dieser Ausführung kommt das Gericht auch hier wieder zu einer Schlussfolgerung, die zu dem vorher ausgeführten nicht wirklich passt: «Auch die subjektive Tatschwere ist als noch leicht zu beurteilen.»
Wirklich?
Just an diesem Punkt setzt die Kritik derjenigen an, die INSIDE JUSTIZ in den letzten Tagen zu dem Urteil befragen konnte. Ein Rechtsanwalt, der nicht namentlich genannt werden möchte, verweist darauf, dass eine leichte Tatbegehung, wie sie das Regionalgericht Plessur hier festhält, bei einer Vergewaltigung eigentlich für Fälle reserviert sein dürfte, wo die sexuellen Handlungen zunächst vielleicht noch einvernehmlich sind und eine der Personen dann weitergeht, obwohl die andere Person nicht mehr einverstanden ist. Eine andere Juristin merkt an, dass auch die Tatsache, dass der vorgesetzte Richter sich an einer ihm unterstellten Praktikantin verging und das offensichtliche Hierarchiegefälle schamlos ausnützte, hätte dazu führen müssen, dass die subjektive Tatschwere eben nicht mehr als leicht, sondern als mittelschwer beurteilt werden müsse.
Aufgrund dieser Einordnung der Schwere der Tat kommt das Gericht zu einer «Einsatzstrafe» von 26 Monaten. Davon gewährt sie dem Täter dann einen Rabatt von 3 Monaten, begründet mit der «medialen Vorverurteilung», die im vorliegenden Verfahren «massiv» gewesen sei. Zitat aus dem Urteil: «Diese fand nicht nur im Untersuchungsverfahren der Staatsanwaltschaft, sondern speziell auch während der Phase nach der Hauptverhandlung bis zur Urteilseröffnung statt, wobei auch die Unschuldsvermutung und insbesondere das Recht auf ein faires Verfahren, in dem sowohl belastende als auch entlastende Umstände untersucht werden, tangiert wurden. Dabei wurden von einzelnen Medienvertretern auch Passagen aus der Hauptverhandlung falsch und aus dem Kontext gerissen wiedergegeben, was eine einseitige und nicht mehr sachliche Berichterstattung zur Folge hatte.»
Welche Aussagen das konkret gewesen sein sollen, nennt das Gericht dann allerdings nicht. Ein Journalist, der dabei gewesen war und über den Fall berichtete: «Mir erscheint, dass das Gericht hier eher seine eigenen Wunden leckt und den Sack schlägt, obwohl es den Esel meint.» Tatsächlich hatte die Berichterstattung in vielen Medien weniger eine Vorverurteilung des Beschuldigten im Sinne, als Kritik an der Untersuchung, sei es durch die Staatsanwaltschaft als auch das Regionalgericht, deren Prozessführung immerhin zu einer spontanen Demonstration von mehr als 200 Personen in der Churer Innenstadt geführt hatte.
Keine strafverschärfende Momente
Strafverschärfende Elemente erkennt das Gericht nicht: «Das Vorleben und das Nachtatverhalten des Beschuldigten wirken sich neutral aus, weshalb er zu einer Freiheitsstrafe von 23 Monaten zu verurteilen ist. An die Strafe ist die erstandene Polizeihaft von 1 Tag anzurechnen.» Auch in diesem Punkt wundern sich Juristen: Insbesondere der Punkt, dass der Richter nach der Tat gegen dieselbe Person noch einmal delinquierte und ihr und sogar noch ihrem Freund vor deren Anwaltsprüfungen Drohbriefe schickte des sinngemässen Inhalts, es sei dafür gesorgt, dass sie die Prüfungen nicht bestehen würden, hätte sich zwingend strafverschärfend auswirken müssen, monieren die Kritiker. Ebenso der Umstand, dass der Täter kein Kondom benützte – siehe unten.
Vergleich mit anderen Urteilen
Wie steht das Regionalgericht Plessur mit seinem Urteil im Vergleich zu anderen Vergewaltigungsdelikten da? Ein direkter Vergleich bleibt schwierig, weil in der Casuistik jeder Fall aufgrund der konkreten Begleitumstände in sich einzigartig ist und kein jüngerer Fall bekannt ist, bei dem ein Vorgesetzter seiner Praktikantin wochenlang nachgestellt und sie dann schliesslich vergewaltigt hätte.
Und nicht nur das: Auch die Rechtsprechung des Bundesgerichts in Sachen Sexualstraftaten ist des Leides voll, Kritiker bemängeln regelmässig die inkonsistente Praxis. Erst vor Jahresfrist, am 15. Oktober 2024, musste das Bundesgericht selbst in einer Medienmitteilung eine Aussage aus einem eigenen Urteil richtigstellen, weil dieses derart viel Kritik erfahren hatte. Im Urteil 7B_15/2021 vom 19. September 2023 hatte das Bundesgericht sinngemäss geschrieben, die relativ kurze Dauer einer Vergewaltigung stelle einen Faktor dar, der schuldmindernd zu berücksichtigen sei. Ein Jahr später, am 3. Oktober 2024 hielt das Bundesgericht diese Aussage selbst für unangemessen und stellte in Urteil 6B_612/2024 klar, dass die Dauer eines Sexualdeliktes grundsätzlich keinen Hinweis auf die Schwere der Tat darstellen könne und dass eine kurze Vergewaltigung keinen Strafrabatt begründe, während hingegen eine besonders lange Tatausführung auf eine höhere kriminelle Energie hinweisen und damit schulderhöhend zu berücksichtigen sei.
Interessant und vielleicht am ehesten vergleichbar ist ein Urteil des Zürcher Obergerichts, das vom Bundesgericht eben erst medienträchtig kassiert wurde: Ein Mann aus dem Kosovo hatte einer Frau eine Liebesbeziehung vorgespielt, ihr die Einreise aus dem Kosovo in die Schweiz ermöglicht und für sie ein Hotelzimmer angemietet. Dort hatte sie Zungenküsse zugelassen und auch, dass sie sich auszogen, wehrte sich aber gegen mehr. Der Mann hielt sie an den Händen fest, vergewaltigte sie ohne Kondom und vollzog Analverkehr. Das Bezirksgericht Bülach erkannte in Summe auf eine Freiheitsstrafe von 32 Monaten, davon 12 Monate unbedingt. Das Zürcher Obergericht reduzierte die Strafe dann auf 24 Monate bedingt. In Entscheid 6B_905/2024 hob das Bundesgericht den Obergerichtsentscheid auf; das Obergericht habe zu milde geurteilt.
Interessant: Unter anderem habe das Obergericht es verpasst, den Verzicht auf ein Kondom straferhöhend zu berücksichtigen, obwohl die jüngere Rechtsprechung des Bundesgerichts das verlange. Ob vorliegend von einem leichten oder mittelschweren Tatverschulden auszugehen sei, legte das Bundesgericht nicht explizit fest; rügte aber, dass «die Bewertung des Tatverschuldens durch die Vorinstanz auch im Ergebnis nicht nachvollziehbar» sei.
Weitere Vergleichsurteile lassen kaum Schlüsse zu
Schon zwei Mal befasste sich das Bundesgericht mit dem Fall eines Hobbyfotografen aus Freiburg. Der hatte über soziale Medien Frauen kostenlose Foto-Shootings angeboten, in deren Verlauf er die Frauen dann zu sexuellen Handlungen nötigte und diese filmte. Das erstinstanzliche Gericht hatte den 50-jährigen Mann zu 11 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, das Freiburger Kantonsgericht reduzierte zunächst auf 30 Monate, davon die Hälfte unbedingt. Das war dem Bundesgericht in einer ersten Beschwerde zu wenig – es wies den Fall ans Kantonsgericht zurück (Urteil 6B_800/2022). Das verurteilte den Mann im zweiten Anlauf nun zu sechs Jahren unbedingt. Dieses Urteil hatte bei einer erneuten Beschwerde am Bundesgericht jetzt aber Bestand (Urteil 6B_535/2025).
In Urteil 6B_1377/2022 des Bundesgerichts vom 20. Dezember 2023 wurde das Urteil gegen einen Mann aus dem Wallis bestätigt. Er wurde für eine Vergewaltigung zu 20 Monaten bedingt verurteilt. Die Frau, so das Urteil, sei maximal mit gegenseitigem Küssen einverstanden gewesen, wollte aber nicht weitergehen und habe mehrfach «Nein» gesagt. Der Mann liess aber nicht locker, bis sie irgendwann mitgemacht habe. Das Walliseller Kantonsgericht beurteilte die Tatschwere hier «als noch nicht im mittleren Bereich».
In Entscheid 6B_1192/2021 vom 7. März 2023 beurteilte das Bundesgericht einen Entscheid des Aargauer Obergerichts. In dem Fall hatte ein angetrunkener Vergewaltiger sein Opfer erst mit einem Brotmesser bedroht, esdann mit dem Messer leicht verletzt und es anschliessend vergewaltigt. Das Obergericht war in Bezug auf die Vergewaltigung wegen des Messers von einer schweren objektiven Tatschwere ausgegangen, auch wenn der Täter es während der Vergewaltigung nicht als Nötigungsmittel einsetzte. Weil der Täter betrunken gewesen war und damit seine Steuerungsfähigkeit minimal eingeschränkt gewesen sei, ging es in Summe von einer mittelschweren Tatschwere aus. Der vorbestrafte Täter kassierte für die Gesamtheit der Delikte neben einer Landesverweisung eine unbedingte Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten.
Titelbild: KI (ChatGPT)
Kritik schon vor dem schriftlichen Urteil
Der Fall der behaupteten Vergewaltigung am Bünder Verwaltungsgericht im Dezember 2021 hatte in den Medien schon verschiedentlich für Justizkritik gesorgt. Zunächst, weil die Bündner Staatsanwaltschaft wochenlang nichts unternommen und Untersuchungshandlungen unterlassen hatte. Dadurch waren die ersten Straftaten bereits verjährt, bevor das Regionalgericht Plessur die Hauptverhandlung auch überhaupt nur durchführte.
Aber auch das Regionalgericht Plessur, das über den Fall in der Besetzung Bettina Flütsch, Paul Schwendener und Hermi Saluz richtete, musste sich Kritik gefallen lassen. – Aus unterschiedlichsten Gründen: Zum einen hat im Spruchkörper mit Hermi Saluz ein Mitte/CVP-Richter mitgewirkt – der Beschuldigte war früher Ortsparteipräsident eben dieser Partei. Überhaupt hatte sich die Frage gestellt, ob das Regionalgericht Plessur den Fall überhaupt ordentlich verhandeln kann. So finden sich auch jetzt in der Urteilsbegründung wieder Passagen aus Aussagen des Opfers, in welchen sie schildert, wie eng der Beschuldigte mit den Gerichtspersonen am Regionalgericht verbandelt sei.
Das Kantonsgericht erteilte in einem Verfahren zu der Befangenheit, welches die Bündner Staatsanwaltschaft ausgelöst hatte, dem Regionalgericht Plessur allerdings einen Persilschein und sah den Verfassungsgrundsatz nicht verletzt, dass ein Richter nicht einmal den Anschein der Befangenheit haben dürfe.
Weitere Kritik setzte es schliesslich ab, weil sich das Gericht für die schriftliche Urteilszustellung rund ein Jahr Zeit liess. Damit verstösst das Regionalgericht Plessur explizit gegen das Gesetz. Die Strafprozessordnung legt in Art. fest, dass ein schriftliches Urteil innerhalb von drei Monaten nach der Hauptverhandlung zugestellt sein müsse – bei sehr komplexen Fällen allenfalls nach sechs. Die NZZ AM SONNTAG nahm das zum Anlass, in einem Beitrag aufzuzeigen, wie die Verzögerung einem Beschuldigten zuspielt und dem Opfer weiteren Schaden zufügt.
§ 86a StGB. Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen
1Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. im Inland Kennzeichen einer der in § 86 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 oder Absatz 2 bezeichneten Parteien oder Vereinigungen verbreitet oder öffentlich, in einer Versammlung oder in einem von ihm verbreiteten Inhalt (§ 11 Absatz 3) verwendet oder
2. einen Inhalt (§ 11 Absatz 3), der ein derartiges Kennzeichen darstellt oder enthält, zur Verbreitung oder Verwendung im Inland oder Ausland in der in Nummer 1 bezeichneten Art und Weise herstellt, vorrätig hält, einführt oder ausführt.
2 Kennzeichen im Sinne des Absatzes 1 sind namentlich Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, Parolen und Grußformen. Den in Satz 1 genannten Kennzeichen stehen solche gleich, die ihnen zum Verwechseln ähnlich sind.
3 § 86 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.