Während der Europäische Gerichtshof Millionen Dieselbesitzern in der EU neuen Hoffnung auf Entschädigung gibt, stehen die betroffenen Fahrzeughalter in der Schweiz weiterhin mit leeren Händen da. Ein Gerichtsurteil von historischer Tragweite offenbart eine tiefe Kluft im europäischen Verbraucherschutz – und wirft ein bezeichnendes Licht auf die juristische Isolation der Schweiz im Abgasskandal.
Am 1. August 2025 fällte der Europäische Gerichtshof (EuGH) ein Urteil mit weitreichender Wirkung: Hersteller wie Volkswagen müssen für Diesel-Fahrzeuge mit illegalen Abschalteinrichtungen haften, auch wenn diese ursprünglich typgenehmigt wurden. Damit wird klargestellt: Der Einbau von sogenannter «Defeat Software» – also Technologien, die Emissionswerte nur auf dem Prüfstand einhalten – ist auch dann rechtswidrig, wenn die Fahrzeuge formal die Zulassungskriterien erfüllen.
Besonders bemerkenswert: Das Gericht sprach den Anspruch auf Schadensersatz nicht nur Erstkäufern, sondern auch späteren Erwerbern zu – unabhängig von Laufleistung oder Besitzdauer. Dies durchbricht eine bisherige Verteidigungslinie von VW und bringt in vielen Fällen Tausende Euro an Rückerstattung ins Spiel.
«Ein Meilenstein für den Verbraucherschutz»
Rechtsanwälte, die Geschädigte vertreten, zeigen sich erfreut. Marco Rogert, ein auf Abgasskandale spezialisierter Anwalt aus Deutschland, spricht gegenüber dem Focus von einem „juristischen Durchbruch“: «Der EuGH hat heute klargestellt, dass VW für unzulässige Abschalteinrichtungen haftet – auch ohne Vorsatznachweis. Eine Entschädigung zwischen fünf und 15 Prozent des Kaufpreises ist realistisch.»
Auch die Kanzlei Gansel Rechtsanwälte, die das EuGH-Verfahren aktiv begleitete, betont die Bedeutung des Urteils: «Unsere Mandanten haben bewusst auf einen Vergleich verzichtet, um eine Grundsatzentscheidung zu erzwingen. Jetzt profitieren Millionen Dieselbesitzer in der EU.» Aus Grossbritannien meldet sich Slater and Gordon, eine der führenden Kanzleien im dortigen Dieselgate-Komplex, zu Wort: «Dieses Urteil bestätigt, was unsere Mandanten seit Jahren vermuten: VW hat gezielt betrogen. Der Schaden ist real, der Rechtsanspruch nun europäisch anerkannt.»
Und auch die US-Kanzlei Hagens Berman, die bereits 2015 als erste in den Vereinigten Staaten Klage gegen Volkswagen einreichte, verweist auf die globale Bedeutung der juristischen Aufarbeitung: «Die USA haben früh gehandelt. Die europäische Entscheidung setzt nun ein spätes, aber starkes Signal.»
Schweizer Kunden: betrogen, aber rechtlos
Ganz anders stellt sich die Lage in der Schweiz dar. Auch hier wurden Tausende Fahrzeuge mit der gleichen Manipulationssoftware verkauft. Auch hier waren die Käufer getäuscht, auch hier ging es um Emissionswerte, die im Realbetrieb drastisch über dem Erlaubten lagen. Doch während deutsche, österreichische oder belgische Käufer nun auf Schadensersatz hoffen dürfen, haben sich die rechtlichen Türen in der Schweiz längst geschlossen.
2017 reichte die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) im Namen von rund 6’000 Betroffenen Klage ein. Die Idee: eine sogenannte «Sammelklage», wie sie in vielen EU-Ländern möglich ist. Doch die Schweiz kennt dieses Rechtsinstrument nicht. Das Verfahren scheiterte letztlich im Mai 2023 vor dem Bundesgericht. Die Begründung: Es liege kein haftpflichtrechtlich relevanter Schaden vor – eine Entscheidung, die Verbraucherschützer bis heute empört.
Die Bundesanwaltschaft stellte zudem im Oktober 2024 ein strafrechtliches Verfahren gegen Volkswagen ein. Grund: In Deutschland sei bereits ein Bussgeld verhängt worden – eine Doppelverfolgung daher unzulässig. Die Konsequenz: Weder strafrechtlich noch zivilrechtlich wurde Volkswagen in der Schweiz zur Rechenschaft gezogen.
AMAG
Im Rahmen des VW-Dieselskandals setzte die AMAG als Generalimporteurin von Volkswagen in der Schweiz auf eine vor allem technisch ausgerichtete Kommunikationsstrategie. Öffentlich betonte das Unternehmen, dass für sämtliche betroffenen Fahrzeuge in der Schweiz rasch Lösungen gefunden und umfassende Umrüstungen durchgeführt worden seien – insgesamt wurden rund 165’000 Autos einem Software-Update oder einer technischen Anpassung unterzogen. Die AMAG stellte dabei heraus, dass die betroffene Software keinerlei Einfluss auf die Sicherheit oder das Fahrverhalten der Fahrzeuge gehabt habe und sich die Umrüstungen für die meisten Kunden problemlos gestalten hätten.
Entschädigungszahlungen gab es in der Schweiz keine. Stattdessen verteilte die AMAG symbolische Goodwill-Geschenke, etwa Schweizer Sackmesser, an betroffene Kunden. Konsumentenorganisationen und verschiedene Medien kritisierten dieses Vorgehen sowie die insgesamt defensive und zurückhaltende Kommunikationspolitik. Besonders bemängelt wurden die zurückhaltenden Formulierungen in den offiziellen Kundenanschreiben, in denen die Tragweite des Skandals aus Sicht der Kritiker verharmlost wurde.
Politisch blockiert – juristisch isoliert
Dass das Rechtssystem der Schweiz für kollektive Klagen keine Handhabe bietet, ist nicht neu. Doch der Fall VW zeigt drastisch, wie sehr Konsumentenrechte in der Schweiz im internationalen Vergleich hinterherhinken. Kritik kommt nicht nur von Anwälten und Verbänden, sondern auch aus dem politischen Raum – bisher allerdings weitgehend folgenlos. Reformvorschläge zur Einführung von Musterklagen oder gruppenbasierten Rechtsdurchsetzungen liegen auf Eis.
Volkswagen und der offizielle Importeur AMAG mussten in der Schweiz bislang keinerlei Entschädigungszahlungen leisten. Eine juristische und moralische Schieflage, die die Schweiz zunehmend isoliert: «Während in der EU ein breiter Verbraucherschutz greift, werden Schweizer Kunden abgewimmelt – obwohl sie vom gleichen Betrug betroffen sind», so ein ernüchterndes Fazit aus einem SKS-Kommentar.
Die juristische Zukunft: Ein Flickenteppich
Das EuGH-Urteil könnte in der EU neue Dynamiken auslösen – auch bei anderen Herstellern wie Daimler, BMW oder Fiat, die ebenfalls wegen illegaler Abschalteinrichtungen in der Kritik stehen. In Deutschland laufen bereits Folgeklagen, auch Verbraucherschutzverbände und Legal-Tech-Firmen bereiten Sammelverfahren vor. Die Erfolgsaussichten sind gestärkt – der Druck auf die Autobranche wächst.
In der Schweiz jedoch bleibt alles beim Alten: Ohne politische Initiative bleibt das kollektive Klagerecht ausser Reichweite. Einzelklagen sind theoretisch möglich, praktisch aber kaum durchsetzbar – zu hoch sind die Kosten, zu unsicher die Erfolgsaussichten.
***
Eine Ohrfeige – nicht nur bei VW, sondern auch beim Schweizer Rechtsschutz
Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 1. August 2025 (Rs. C‑666/23) ist nicht nur ein juristischer Meilenstein – es ist eine Ohrfeige für all jene, die jahrelang versucht haben, die juristische Verantwortung für systematische Verbrauchertäuschung wegzudefinieren. Mit bemerkenslicher Klarheit stellt das Gericht fest: Ein manipuliertes Fahrzeug ist mangelhaft – Typgenehmigung hin oder her. Die Verbraucher haben Anspruch – auch wenn sie das Auto gebraucht gekauft haben, auch wenn sie Vielfahrer sind, auch wenn sich die Hersteller bis zuletzt mit haarspalterischen Ausreden verteidigten.
In der EU kann man dieses Urteil als späten Triumph des Verbraucherschutzes feiern. In der Schweiz dagegen wird es zur bitteren Erinnerung daran, wie schlecht Konsumenten hierzulande geschützt sind. Denn Schweizer Kunden wurden im Dieselskandal genauso betrogen wie ihre europäischen Nachbarn – aber sie blieben auf dem Schaden sitzen. Nicht, weil der Betrug weniger gravierend war. Nicht, weil die Fahrzeuge dort ehrlicher liefen. Sondern weil das Schweizer Recht ihnen schlicht kein Werkzeug in die Hand gibt, um sich kollektiv zur Wehr zu setzen. Keine Sammelklagen. Kein Verbandsklagerecht. Kein funktionierendes System für Musterprozesse. Stattdessen bleibt nur der steinige Weg der Einzelklage – teuer, langwierig, mit hohem Kostenrisiko.
Und die Politik? Sie sah tatenlos zu. Nach Bekanntwerden des Dieselskandals 2015 hätte das Parlament die strukturelle Schwäche des Rechtsschutzes angehen können. Doch ausser parlamentarischen Vorstössen ohne Durchschlagskraft geschah – nichts. Kein Bundesgesetz zur kollektiven Rechtsdurchsetzung. Kein Ausbau der Klagerechte für Konsumentenorganisationen. Stattdessen: Rechtsnihilismus im Dienste der Wirtschaft.
Volkswagen und der Generalimporteur AMAG mussten in der Schweiz bis heute keine Entschädigung leisten. Die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) scheiterte vor dem Bundesgericht mit dem Versuch, rund 6.000 Betroffene gemeinsam zu vertreten. Die Richter entschieden, dass kein haftpflichtrechtlich relevanter Schaden vorliege – eine Argumentation, die in Deutschland, Frankreich oder Österreich längst vom Tisch ist. Strafrechtlich? Auch hier: Verfahren eingestellt. Keine Sanktionen. Kein Prozess. Keine Transparenz.
Während Europas Gerichte dem grössten Industrieskandal der letzten Dekade endlich juristische Konsequenzen folgen lassen, bleibt die Schweiz juristisch im Halbschlaf. Die Parole scheint zu lauten: „Verbraucherschutz, ja – aber bitte ohne Zähne.“ Ein Rechtssystem, das internationalen Konzernen erlaubt, seine Kunden ungestraft zu täuschen, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, nicht neutral, sondern machtvergessen zu sein.
Titelbild: Dino Graf von der AMAG/Screenshot SRF Kassensturz
Was der EuGH konkret entschieden hat
In seinem Urteil vom 1. August 2025 stellt der Europäische Gerichtshof (EuGH) klar: Fahrzeughersteller wie Volkswagen haften auch dann für den Einbau unzulässiger Abschalteinrichtungen, wenn das betroffene Fahrzeug eine EG‑Typgenehmigung besitzt.
Der EuGH betont dabei mehrere Kernpunkte:
- Unzulässige Abschalteinrichtungen verstossen gegen europäisches Zulassungsrecht – auch wenn die betroffenen Fahrzeuge formell genehmigt wurden.
- Ein Hersteller kann sich nicht auf einen „unvermeidbaren Verbotsirrtum“ berufen, wenn er die Funktionen technisch bewusst implementiert hat.
- Für einen Schadensersatzanspruch ist kein Vorsatz erforderlich. Es reicht aus, dass das Fahrzeug nicht der vertraglich geschuldeten Beschaffenheit entspricht.
- Folgekäufer – also Personen, die ein betroffenes Fahrzeug gebraucht gekauft haben – haben ebenfalls Anspruch auf Entschädigung, da der Mangel fortbesteht.
- Das Gericht legt keine fixe Entschädigungssumme fest, verweist jedoch auf nationale Gerichte, die in der Regel zwischen 5 und 15 % des Kaufpreises als Ausgleich zusprechen.
„Ein Fahrzeug, das mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung ausgestattet ist, stellt eine mangelhafte Kaufsache dar, auch wenn es über eine Typgenehmigung verfügt. […] Ein Ersatzanspruch des Käufers ist nicht ausgeschlossen, wenn der Hersteller fahrlässig gehandelt hat.“
(EuGH, Rs. C‑666/23, Rn. 71–73)
Europäischer Gerichtshof (EuGH)
- EuGH, Urteil vom 1. August 2025, Rs. C‑666/23
Der deutsche Fall wurde dem EuGH vom Landgericht Ravensburg vorgelegt und betrifft die Haftung von Volkswagen trotz EG‑Typengenehmigung und die Zulässigkeit von Abschalteinrichtungen. Die Entscheidung verneint einen Verbotsirrtum und bestätigt den 5–15 % Schadensersatzrahmen. EuGH, Rs. C‑666/23, Rn. 71–73.
Schweizer Bundesgericht
- Bundesgericht, Urteil vom 9. Mai 2023, Az. 4A_17/2023 bzw. 4A_18/2023
Dabei ging es um eine Klage eines Fahrzeughalters gegen VW/AMAG. Das Urteil wies Ansprüche auf Rückzahlung oder Schadensersatz ab, weil kein haftpflichtrechtlich relevanter Schaden im Sinne des Schweizer Rechts gesehen wurde. myright.de und Beobachter
Hintergrund zu Schweizer Sammelklagen
- SKS / Handelsgericht Zürich, Dezember 2017
Die Stiftung für Konsumentenschutz reichte eine Klage für rund 6.000 Geschädigte ein – mit dem Ziel einer Verbandsklage. Das Verfahren wurde vom Handelsgericht Zürich bereits 2018 abgelehnt, das Bundesgericht bestätigte diese Entscheidung 2019. Eine nähere inhaltliche Prüfung des Schadens wurde nicht vorgenommen Stiftung für Konsumentenschutz. - myRight Sammlungsklage-Verfahren
Eine deutsche Sammelklage für Schweizer Geschädigte wurde 2023 eingestellt, obwohl der BGH (Az. VIa ZR 418/22) die internationale Klagebefugnis grundsätzlich anerkannte. Letztlich verhinderten jedoch die fehlende Anspruchsgrundlage nach Schweizer Recht die Weiterführung des Insolvenzverfahrens. myRight
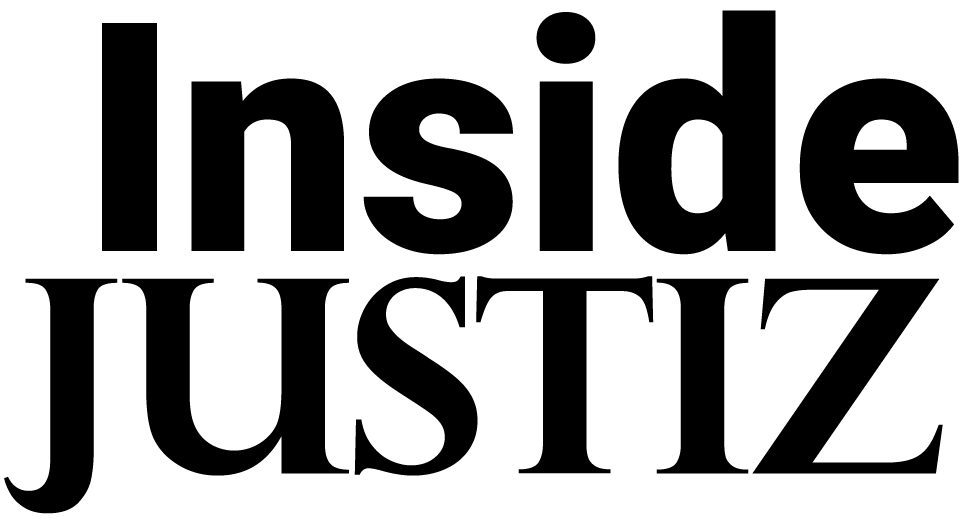
Es gibt kein „Abgasskandal“!
Das Ganze war vom Anfang an eine orchestriete Kampagne der USA um die Deutsche Autoindustrie zu schädigen. Due Luft, die hinter einem modernen Dieselmotor herauskommt, ist reiner als die angesaugte Luft.
Ähnlich behindert war schon damals die Entschädigjng von Porsche an Paul Walkers Tochter (>10 Mio) – als wäre es der Fehler von Porsche wenn ein Schauspieler mit übersetzter Geschwindugkeit in eknen Pfeiler fährt!
Und wofür genau sollen eigentlich die Autobesitzer entschädigt werden, es liegt ja gar kein Schaden vor.
„Ein Rechtssystem, das internationalen Konzernen erlaubt, seine Kunden ungestraft zu täuschen, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, nicht neutral, sondern machtvergessen zu sein.“
Ich nenne dieses Schweizer Rechtssystem korrupt. Sowohl das letztinstanzlich entscheidende Bundesgericht als auch die Bundesanwaltschaft (siehe oben). Punkt.