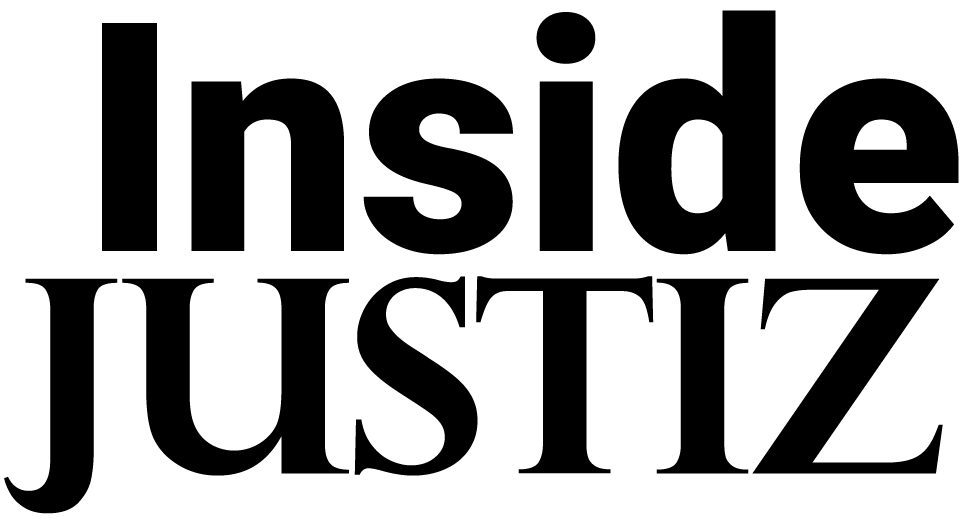Der Turnschuhfabrikant On gilt als eines der erfolgreichsten Schweizer Start-Ups der letzten Jahre. 2010 gegründet, schrieb das Unternehmen letztes Jahr einen Umsatz von CHF 2.3 Mia. Jetzt könnte dem Unternehmen Ungemach drohen: Chinesische Behörden stellen unangenehme Fragen, weil On an ihren Turnschuhen das Schweizerkreuz verwendet – und auch die Schweizer Wirtschaft stellt sich gegen «On». Die On-Gründer versuchen derweil, die Verteidiger des Schweizerkreuzes mit massivem Powerplay unter Druck zu setzen.
«Schweizer Behörde verpfeift Schweizer Firma in China.» Die BLICK-Schlagzeile vom Mittwoch war wohl ebenso falsch wie klar darauf ausgerichtet, die Emotionen hochzukochen. Die Schweizer Swissness-Aufseher hätten in China ein Verfahren gegen den Turnschuh-Fabrikanten losgetreten, und drei Bundesräte hätten sie nicht zurückgepfiffen, schrieb der Blick. Die Stossrichtung war klar: Böse Aufseher, böse Beamte, armer Milliardenkonzern. Nun, dank der NZZ von heute Morgen und Akten, die INSIDE JUSTIZ einsehen konnte, ist klar: Die Sache war doch etwas anders, als der BLICK insinuieren wollte.
Aber worum geht’s genau?
Streitpunkt sind Bestimmungen aus dem eidgenössischen «Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben» – kurz Markenschutzgesetz oder MSchG. Und dort die Regeln über die Herkunftsbezeichnungen, die oftmals auch einfach als «Swissness-Gesetz» apostrophiert werden.
Das Gesetz war das Resultat eines langen politischen Prozesses. Die Botschaft des Bundesrates für das Gesetz wurde bereits am 18. November 2009 verabschiedet, in Kraft trat der Gesetzestext schliesslich am 1. Januar 2017. Die verschiedensten Branchen der Schweizer Wirtschaft brüteten dabei immer wieder über den Textvarianten. Denn: Der Teufel liegt bekanntlich im Detail – auch wenn die Stossrichtung grundsätzlich unbestritten war.
Und die lautete: Schweizer Produzenten sollen vor Trittbrettfahrern geschützt werden, indem Schweizer Hoheits- und Bildzeichen wie die Helvetia, das Matterhorn, Wilhelm Tell oder auch das Schweizerkreuz nur auf Produkten verwendet werden dürfen, wenn die Produkte tatsächlich aus der Schweiz kommen. Also: Hier produziert werden. Die Kriterien dafür sind im Gesetz klar festgelegt.
Herstellungskosten: 60% in der Schweiz
Für «Industrieprodukte», und dazu zählen auch industriell gefertigte Turnschuhe, sagt Art. 48c MschG, dass 60% der Herstellungskosten in der Schweiz anfallen müssen, und dazu die Tätigkeiten, welche «dem Produkt seine wesentlichen Eigenschaften verliehen». Das soll sicherstellen, dass keine belgischen Schokoladeproduzenten ein Matterhorn auf ihrer Verpackung abbilden dürfen – oder eben ein chinesischer Billiganbieter Taschenmesser mit dem Schweizer Kreuz auf den Markt bringt, die dann in direktem Wettbewerb stehen mit den qualitativ hochwertigen Victorinox-Messern, die auch tatsächlich in der Schweiz gefertigt werden und die hiesigen regulatorischen Anforderungen erfüllen müssen.
Am wichtigsten dürfte der Schutz aber womöglich für die Uhrenindustrie sein, für die wichtig ist, dass Schweizer Uhren auch wirklich solche bleiben. Die Regeln sind hart: Kuhn-Rikon beispielsweise produziert einen Teil seiner Pfannen in der Schweiz. Diese dürfen das Schweizerkreuz tragen. Andere werden im Ausland gefertigt. Auf diesen fehlt dann allerdings das Schweizerkreuz.
Höherer Preis dank Swissness
Dass die Produzenten aller möglicher Güter gerne Schweizer Symbole verwenden, ist notorisch – und hat seinen Grund.
Studien zeigen, dass Menschen weltweit bereit sind, für Schweizer Produkte eine «Premium Fee» zu bezahlen von durchschnittlich 20% – bei Luxusgütern wie Uhren sogar noch deutlich mehr, bei anderen Produkten etwas weniger. Mit anderen Worten: Menschen rund um den Globus gehen davon aus, dass Schweizer Produkte aufgrund ihrer Qualität einen höheren Preis rechtfertigen und sind bereit, einen solchen zu bezahlen.
Der Fall «On»
On nützt diese Premium-Fee aus und positioniert ihre Schuhe preislich höher als die Konkurrenz. Bezogen auf den Herstellungsort ist die Sache unbestritten: On produziert ihre Sneakers in Asien, insbesondere in Indonesien und Vietnam. Und damit ist On nicht auch nicht berechtigt, die Turnschuhe mit dem Schweizerkreuz zu versehen. Sagen diejenigen Organisationen, welche die Schweizer Hoheitszeichen gegen Trittbrettfahrer schützen – wir kommen auf sie zurück.
On sieht das anders. Die Firma um die drei Gründer Olivier Bernhard, David Allemann und Caspar Coppetti fühlt sich durch und durch schweizerisch. «Wir beschäftigen am Firmensitz in der Schweiz ein Team von 1’100 Leuten, 300 davon alleine in Entwicklung, Forschung und Produktdesign. Wir entwickeln völlig neue Technologien und stehen für die Innovationskraft der Schweiz», sagt Unternehmenssprecher Adib Sisani gegenüber INSIDE JUSTIZ. Für ihn und On macht das die Swissness aus, «wir sollten Swissness nicht einfach auf die Produktion beschränken, sondern die gesamte Wertschöpfung, die in der Schweiz erfolgt, einbeziehen.»
Interessant: In der Schweiz verkauft On seit geraumer Zeit keine Schuhe mehr mit dem Schweizerkreuz – was sich eigentlich nicht anders erklären lässt, als dass dem Shootingstar der Turnschuhbranche sehr wohl bewusst war, dass er mit dem Schweizerkreuz in der Schweiz halt gegen geltendes Schweizer Recht verstossen und damit Sanktionen auslösen würde – bis hin zu strafrechtlichen.
Vogelfrei im Ausland?
Nur: Bei den ON-Schuhen für das Ausland sahen die On-Unternehmer das bislang anders. Ganz nach dem Motto: Im Ausland können uns die Schweizer Behörden ja nichts anhaben. Und so verkauft ON seine Schuhe ausserhalb der Schweiz mit einer Lasche, auf der das Schweizerkreuz prangt. Davon abgesetzt findet sich der Schriftzug «Swiss Engineering». Darauf wolle man bei On nicht verzichten: «Es geht um den Stolz dafür, was wir in der Schweiz machen und in die Welt tragen», sagt Sisani.
Andere sehen darin ein Foulspiel: On täusche damit die Kunden, gebe vor, ein Schweizer Produkt zu kaufen. Dabei seien die Treter billige Ware aus Asien und lediglich in der Schweiz designt worden.
On sagt, die Problematik liege in einer unterschiedlichen Gesetzesauslegung und beruft sich auf Art. 47 MSchG. In Abs. 3ter steht dort: «Angaben zu Forschung oder Design oder anderen spezifischen Tätigkeiten, die mit dem Produkt im Zusammenhang stehen, dürfen nur verwendet werden, wenn diese Tätigkeit vollumfänglich am angegebenen Ort stattfindet.» Unbestritten ist, dass On ausschliesslich in der Schweiz entwickelt. Das Unternehmen ist deshalb der Ansicht, das rechtfertige, dass sie das Schweizerkreuz verwenden dürften. – Mit dieser Rechtsauffassung stehen sie bislang zwar alleine da. Richtig ist allerdings auch, dass noch nie ein Schweizer oder Internationales Gericht ein Urteil in der Sache gefällt hätte.
Und klar ist auch: Würde sich die Rechtsauffassung von On bei Gericht durchsetzen, dürften sie ihre Sneakers auch in der Schweiz wieder mit Schweizerkreuz verkaufen. – Und gleichzeitig ein ziemliches Chaos auslösen in Sachen Herkunftsbezeichnungen auf Produkten mit Schweizer Bezug. Ausgerechnet, nachdem dieses Rechtsgebiet doch eben erst nach langwierigen Diskussionen in einigermassen geordnete Bahnen gelenkt worden war. Das Nachsehen hätten bei einem positiven Entscheid für On diejenigen Betriebe, die sich nicht nur zum Forschungs- und Entwicklungsstandort, sondern auch zum Produktionsstandort Schweiz bekennen.
«Schweizer Wirtschaft» vs. On?
Tatsächlich ist die Durchsetzung der Schweizer Herkunftsregeln im Ausland schon heute eine Herausforderung. In der Schweiz ist das Institut für geistiges Eigentum IGE die zuständige Schweizer Behörde. Sie hat allerdings kein direktes Durchgriffsrecht in anderen Ländern, es gelten die länderspezifischen Gesetze. Wobei viele Länder unterdessen Vorschriften kennen, um Marken- und Herkunftsangaben zu schützen, damit Konsumentinnen und Konsumenten nicht getäuscht werden.
Auch in China. So steht beispielsweise in Art. 10 des Markenrechts der Volksrepublik China explizit: «Die folgenden Zeichen sollen nicht als Markenzeichen verwendet werden: (2) solche, die mit den Staatsnamen, Nationalflaggen, Hoheitszeichen oder Militärflaggen anderer Länder identisch oder diesen ähnlich sind, es sei denn, die Regierung des anderen Staates stimmt der Verwendung in einer Art und Weise zu.»
Public-Private-Partnership zur Durchsetzung
Um die Regeln im Ausland durchzusetzen, haben die Schweizer Wirtschaft und der Bund gemeinsam den gemeinsamen privatrechtlichen Verein «Swissness Enforcement» gegründet. Er soll im Rahmen einer Public Private Partnership im Ausland für die Durchsetzung der Herkunftsregeln sorgen. Das macht der Verein, indem er z.B. ausländische Behörden auf Verstösse aufmerksam macht.
Präsident von Swissness Enforcement ist Erich Herzog vom Wirtschaftsdachverband Economiesuisse, Vize-Präsident ist Felix Addor, Professor für Immaterialgüterrecht, Verhandlungslehre und Konfliktlösung und Stellvertretender Direktor am Institut für Geistiges Eigentum. Auch bezüglich Mitglieder ist der Verein breit aufgestellt: Der Migros Genossenschaftsbund hilft genauso mit wie Victorinox, Swiss Life oder die Branchenverbände Swissmem, Swiss Textiles oder auch der Branchenverband der Uhren- oder Schokoladenindustrie. Und auch das Institut für Geistiges Eigentum ist Mitglied des Vereins. Durch die vielen Branchenverbände und Grossunternehmen gilt Swissness Enforcement als breit abgestützt und durch die Mitglieder repräsentativ für die Schweizer Wirtschaft.
Klartext von Hayek
Und auch ihnen ist die in ihren Augen rechtswidrige Praxis von On ein Dorn im Auge. Einer, der schon immer Klartext redete, ist Uhrenboss Nicolas Hayek junior. In der Sendung 10VOR10 des SCHWEIZER FERNSEHEN machte der Swatch-Chef schon am 28. März 2025 deutlich, was er von den On-Unternehmern hält: «Wenn wir Tür und Tor öffnen, einfach das Schweizerkreuz zu verwenden, und sich zu foutieren, was der Konsument eigentlich denkt, finde ich das falsch.» Und direkt bezogen auf On: «Die können den Schuh eigentlich in der Schweiz produzieren, die Marke ist stark, sie ist nachgefragt – muss ich denn wirklich noch den letzten Profit herausholen?»
INSIDE JUSTIZ liegen darüber hinaus mehrere aktuelle Schreiben von grossen Branchenverbänden der Schweizer Wirtschaft und Einzelmitgliedern des Swissness Enforcement Vereins vor, in denen sie sich klar dafür aussprechen, die geltenden Regeln allen gegenüber durchzusetzen, auch gegenüber On. Öffentlich äussern möchten sie sich dagegen mehrheitlich nicht.
Die Vereinsmitglieder waren es auch, welche Vorstand und Geschäftsführung beauftragten, die Situation in China zu klären. Mit anderen Worten: Der Druck gegen On kommt nicht aus Amtsstuben und Bundesbern, sondern von der Wirtschaft selbst, die nicht hinnehmen will, dass sie sich an die Regeln hält, während die Zürcher On-Unternehmer Millionen einstreichen und sich um die Fairness-Regeln foutieren.
«On»-Powerplay
Besagtes zeigt auch: Die aktuelle Eskalation zwischen On und dem Rest der Schweizer Wirtschaft ist nicht neu. Swissness Enforcement-Geschäftsführer David Stärkle: «Wir haben On schon vor vier Jahren gewarnt, dass ihre Praxis in China zu Problemen führen könnte.» On habe die Warnungen stets in den Wind geschlagen und auf Zeit gespielt. On Unternehmenssprecher Adib Sisani lässt das nicht gelten: «Es stimmt zwar, dass wir seit mehreren Jahren die Meinungsverschiedenheit führen, aber global, nicht in Bezug auf ein einzelnes Land.»
Nach Ansicht des On-Sprechers würden viele andere Firmen das chinesische Markenrecht genauso wenig beachten und nennt auch Namen: «Ob auf Produkten von Kaffee, Trinkflaschen, Küchengeräte oder auch in Logos von Schweizer Unternehmen: Der Logik des Vorgehens von IGE und Swissness Enforcement folgend missbrauchen sie alle das chinesische Markenrecht», sagt er im Gespräch mit INSIDE JUSTIZ.
Bei einem Treffen am 16. Juni dieses Jahres machte Swissness Enforcement gegenüber dem On Management klar, dass man bis Ende August Lösungen erwarte, wie sie das Problem zu lösen gedächten. «Ein Vorschlag war beispielsweise, dass wir andere Farben für das Schweizerkreuz verwenden.» Der Vorschlag sei an diesem Termin zum ersten Mal gemacht worden und man sei so verblieben, dass On bis Ende August die Vorschläge prüfen würde, sagt Sisani. Umso verärgerter sei man gewesen, als noch vor Ablauf der Frist die chinesischen Behörden auf sie zugekommen seien. On reagierte mit einem geharnischten Protest an Swissness Enforcement – und kopierte in das Schreiben auch drei Bundesräte ein.
Wie es zu der chinesischen Intervention kam
Darüber, warum die Chinesen überhaupt bei On vorstellig wurden, gehen die Darstellungen auseinander. On ist überzeugt, dass das Institut für geistiges Eigentum das Unternehmen angeschwärzt habe. Ein Mittelsmann habe eine Vollmacht des IGE vorgelegt. Swissness Enforcement Geschäftsführer David Stärkle bestreitet diese Darstellung: «Richtig ist, dass wir einen Experten beauftragt hatten, Vorabklärungen bei den Chinesen zu treffen und sich nach deren Rechtsauffassung zu erkundigen.» Es gebe weder eine Anzeige noch eine Vollmacht von Swissness Enforcement. Sasani muss auf Nachfrage einräumen, dass die behauptete Vollmacht bereits aus dem Jahr 2019 datierte – sie kann also kaum Gültigkeit für den aktuellen Fall besitzen. Für On spielt das indes keine Rolle: «Die Vollmacht des IGE, unterschrieben unter anderen vom heutigen Vizepräsidenten von Swissness Enforcement, steht in der Anzeige, die gegen On bei der chinesischen Marktaufsicht eingereicht wurde. Das Resultat ist, dass die Chinesen den Vorgang als offiziellen Akt der Schweiz empfinden.»
Schliesslich kam am letzten Mittwoch ein Video-Call zustande, wie heute der TAGESANZEIGER und die NZZ übereinstimmend berichten. Auf Nachfrage von INSIDE JUSTIZ lässt On dazu am Donnerstag ein Statement verbreiten, in dem es heisst: «Im gestrigen Treffen mit IGE und SEA hat On das Angebot wiederholt, die Frage zur Nutzung des Schweizer Kreuzes in Kombination mit der Qualifikation „Swiss Engineering“ erstmals auf dem Schweizer Rechtsweg gerichtlich klären zu lassen. IGE und SEA haben das Angebot positiv und mit Wohlwollen aufgenommen und wollen nun intern rasch die Entscheidung herbeiführen, ob sie den Vorschlag mittragen. Lassen wir das Bundesgericht entscheiden, wofür das Schweizerkreuz stehen darf.»
Die Verteidiger des Schweizerkreuzes haben es anders erlebt
Das Statement von On, das offensichtlich nicht mit den Vertretern der Gegenseite abgestimmt war, ist im besten Falle euphemistisch. Aus dem Umfeld der Sitzungsteilnehmer von Swissness Enforcement tönt es nämlich anders. Diese erinnern sich vielmehr an ein arrogantes Auftreten der On-Leute. On wirft der Gegenseite verschiedene Dokumente hin. Binnen zweier (!) Tage sollen Swissness Enforcement und das Institut für Geistiges Eigentum IGE ein Papier unterschreiben, mit dem sie bescheinigen, dass On sich in Übereinstimmung mit dem Schweizer Recht verhalten habe. Also eine «Carte blanche», die im völligen Widerspruch stünde zur bisherigen Haltung von Swissness Enforcement.
In einer weiteren Vereinbarung geben die On-Unternehmer vor, wie es dann weitergehen soll: Detailliert wird Schritt für Schritt beschrieben, wie über eine zivilrechtliche Klage in der Schweiz geklärt werden soll, ob das Schweizer Kreuz zusammen mit dem Schriftzug «Swiss Engineering» verwendet werden dürfe oder nicht. Das Institut für geistiges Eigentum – immerhin eine Bundesbehörde mit hoheitlichen Verpflichtungen, sollte sich gemäss den Zürcher Unternehmern zu jedem einzelnen Verfahrensschritt vertraglich verpflichten – und müsste sich auch die Hände binden lassen, z.B. strafrechtlich gegen On vorzugehen, sollten diese auf dem Schweizer Markt wieder mit einem Schweizerkreuz auftreten.
Wörtlich: «SEA (für Swiss Enforcement, die Red.) und IGE erklären, während der Dauer der gerichtlichen Auseinandersetzung auf jegliche rechtliche Massnahmen zur Durchsetzung ihrer in dieser Auseinandersetzung zu klärenden Rechtsauffassung im In- und Ausland zu verzichten und alle Handlungen vorzunehmen oder Erklärungen abzugeben, die nötig sind, um allfällige hängige Verfahren zu unterbrechen.» – Das private Unternehmen «On» will der Bundesbehörde also vorschreiben, was es zu tun und zu lassen hat? Verwaltungsrechtler runzeln die Stirn: Die Vorstellungen von On dürften kaum mit den Bestimmungen des Verwaltungsrechts konform gehen, wie eine Behörde vorzugehen hat. Dass insbesondere das IGE auf den Druckversuch von On eingehen könnte, erscheint damit mehr als nur fraglich. Swissness Enforcement wäre in der Frage als privatrechtlicher Verein wohl freier, allerdings bräuchte es einen massiven Meinungsumschwung bei den Mitgliedern.
Sisani will das alles nicht so verstanden haben. Es handle sich hier lediglich um einen Entwurf, selbstverständlich stünde es Swissness Enforcement und IGE frei, andere Vorschläge zu machen oder Formulierungen einzubringen, hinter denen sie stehen könnten. Die forsche Gangart erklärt er damit, dass es schnell gehen müsse, weil die chinesischen Behörden ansonsten ein offizielles Verfahren einleiten würden. «Das hat aber nicht On zu verantworten. Es ist darauf zurückzuführen, dass Swissness Enforcement und IGE in China tätig geworden sind», sagt Sisani.
Muss On eine Intervention der Chinesen befürchten?
Nur: Warum hat On das chinesische Markenrecht nicht früher studiert? Sisani verweist auf das schnelle Wachstum von on und darauf, dass das Unternehmen unter den Schweizer Exporteuren ja nicht alleine stünde. Gleichwohl: Offenbar hat die Compliance mit diesem Wachstum nicht Schritt gehalten. Die Intervention der Chinesen dürfte auf jeden Fall dafür gesorgt haben, dass man in der On-Zentrale das Problem jetzt plötzlich ernst nimmt. Denn: Die Chinesen haben in früheren Fällen bewiesen, dass sie gewillt sind, durchzugreifen. Am 6. Dezember 2021 berichtete BLICK von einer Razzia in Shanghai: Damals wurde die Firma «Swiss Peak» von der dortigen Wettbewerbsbehörde Hopps genommen – Swiss Peak brüstete sich mit allerlei Swissness – vom Namen bis zu Schweizerkreuzen auf den Produkten – ohne mit der Schweiz freilich irgendetwas zu tun gehabt zu haben.
Dem Vernehmen handelt es sich bei der Wettbewerbsbehörde, die nun bei On vorstellig geworden ist, um dieselbe Behörde wie damals. Und die damalige Berichterstattung zeigt, dass die Chinesen nicht nur juristisch durchgreifen, sondern das auch noch publizitätswirksam inszenieren. – Keine schöne Aussicht für die erfolgsverwöhnten On-Unternehmer, deren Aktienpakete in den letzten Quartalen eigentlich nur eine Richtung kannten: Nach oben. Schlagzeilen und Medienberichte über eine Lagerräumung durch die Chinesen wegen der Verletzung von Hoheitszeichen könnten diesen Höhenflug abrupt beenden und die Highflyer brutal abstürzen lassen.
Sisani weist diesbezügliche Befürchtungen zurück und betont das gute Einvernehmen mit den chinesischen Wettbewerbshütern. «Wir arbeiten ja sehr gut mit den chinesischen Wettbewerbsbehörden zusammen und unterstützen sie gegen all’ die Trittbrettfahrer und Markenfälscher. Gerade On ist als Marke so beliebt, dass Fälschungen und Nachahmerprodukte allenthalben bekämpft werden müssen. Und zwar in guter Zusammenarbeit mit nationalen Behörden auf der ganzen Welt.»
Was tun die Chinesen?
Fachpersonen, die sich mit den chinesischen Abläufen auskennen, gehen davon aus, dass die Chinesen von On zunächst einen Nachweis einer Schweizer Behörde verlangt haben – oder noch verlangen werden, wie es ihrem Markenrecht entspricht. On müsste dann belegen, dass sie das Schweizerkreuz mit Billigung der Schweizer Behörden führen. Eine solche Bestätigung müsste nach Schweizer Recht das IGE ausstellen. «Der Vertreter des IGE hat uns diese Woche klar zu verstehen gegeben, dass wir diese aufgrund ihrer Rechtsauslegung nie erhalten würden», sagt Sisani. Gleichwohl: On stünde bei einem abschlägigen Entscheid dann ja der Rechtsweg und damit der gesamte Instanzenzug über Bundesverwaltungsgericht bis zum Bundesgericht offen.
Warum On diesen Weg nicht längst gegangen ist? Sisanis Äusserungen deuten darauf hin, dass dem On-Management der schnelle Erfolg über den Kopf gewachsen ist. Andere denken, er sei ihnen in den Kopf gestiegen. So oder so, ein Risiko bleibt: Niemand weiss, ob die Chinesen die Füsse stillhalten und abwarten würden, falls On ein Verfahren wie oben skizziert losgetreten würde.
Titelbild: Um die kleine Lasche dreht sich der Streit: Schweizerkreuz an einem Turnschuh von On.

So erfolgreich, so umstritten
Seit Oktober 2022 glich der Aktienchart der On Holding dem Profil eines anspruchsvollen Berglaufs – mit einem einzigen tieferen Abstieg, als Donald Trump im April seinen «Liberation Day» feierte. Wer Ende September 2022 bei einem Börsenwert von USD 16 einstieg, kann sich aktuell bei rund USD 45 praktisch über eine Verdreifachung seines Investments freuen. Der Börsenwert spiegelt Umsatz- und Gewinnentwicklung. 2024 wies die On Holding einen Umsatz von CHF 2.32 Mia. aus, was einer Steigerung um rund 30% gegenüber dem Vorjahr entsprach. Der Nettogewinn sprang um sagenhafte 204% auf CHF 242 Mio.
Im Oktober 2024 machten die On-Gründer Schlagzeilen, weil sie grosse Aktienpakete aus ihrem persönlichen Bestand verkauften: Caspar Coppetti liess sich für ein Aktienpaket CHF 23 Mio. gutschreiben, Daniel Allemann löste CHF 20 Mio. und Olivier Bernhard verkaufte Papiere im Wert von CHF 11 Mio. Auch bei den Löhnen waren die Unternehmer grosszügig mit sich selbst. «So dreist sind die Wahnsinnslöhne der On-Schuh-Millionäre im Vergleich mit Nike und Co.» titelte WATSON.CH, nachdem sich On-CEO Maurer für 2021 einen Lohn gönnte von immerhin CHF 16.9 Mio.
Aber nicht alles rund um die Treter ist Eitel Sonnenschein. Im Januar 2024 enthüllte das Konsumentenmagazin K-TIPP die Gewinnspanne für ein Paar Schuhe und berichtete auf der Basis von vertraulichen Zolldaten, für den Schuh «Cloudtilt Loewe» beispielsweise, der im Laden für CHF 445 über die Theke geht, würde On der Herstellerfirma Freeview Industrial in Vietnam ganze CHF 20.80 überweisen. Konsumentinnen und Konsumenten bezahlen damit im Laden mehr als das 20ig-fache des Fabrikpreises. Die NZZ konstatierte: «Der Schuhhersteller On hat ein Imageproblem – trotz Roger Federer» (hinter Bezahlschranke).
Dieser war nämlich 2019 als Investor und Markenbotschafter zu On gestossen und hatte später auf dem Tenniscourt On-Schuhe getragen.
Aber auch die Qualität der Schuhe gab immer einmal wieder zu kritischen Beiträgen Anlass. So berichtete der KASSENSTURZ des SCHWEIZER FERNSEHEN am 8. Dezember 2020 von einem Läufer, der sich beklagte, die Sohle hätte sich schon nach kurzer Zeit aufzulösen begonnen und an der Ferse sei ein Loch entstanden – was bei einem Preis von CHF 230 nicht der Konsumentenerwartung entspreche. 2022 bestätigte ein ausführlicher Test im KASSENSTURZ: «Teuer, aber nicht besser.»
Art. 47 Herkunftsangaben und geografische Angaben – Grundsatz
1 Herkunftsangaben sind direkte oder indirekte Hinweise auf die geographische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen.
2 Geographische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, gelten nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Absatz 1.
3 Unzulässig ist der Gebrauch:
- unzutreffender Herkunftsangaben;
- von Bezeichnungen, die mit einer unzutreffenden Herkunftsangabe verwechselbar sind;
- eines Namens, einer Firma, einer Adresse oder einer Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft, wenn sich daraus eine Täuschungsgefahr ergibt.
3bis Werden Herkunftsangaben zusammen mit Zusätzen wie «Art», «Typ», «Stil» oder «Nachahmung» gebraucht, so müssen die gleichen Anforderungen erfüllt werden, die für den Gebrauch der Herkunftsangaben ohne diese Zusätze gelten.
- weiss oder annehmen muss, dass die Widerhandlung mittelbar oder unmittelbar die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann;
- als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelhandels zusammengefunden hat;
- durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt;
- in Ausbildungsstätten vorwiegend für Jugendliche oder in ihrer unmittelbaren Umgebung gewerbsmässig Betäubungsmittel anbietet, abgibt oder auf andere Weise zugänglich macht.
3ter Angaben zu Forschung oder Design oder anderen spezifischen Tätigkeiten, die mit dem Produkt im Zusammenhang stehen, dürfen nur verwendet werden, wenn diese Tätigkeit vollumfänglich am angegebenen Ort stattfindet.
4 Regionale oder lokale Herkunftsangaben für Dienstleistungen werden als zutreffend betrachtet, wenn diese Dienstleistungen die Herkunftskriterien für das betreffende Land als Ganzes erfüllen.
Art. 48c Andere Produkte, insbesondere industrielle Produkte
1 Die Herkunft eines anderen Produkts, insbesondere eines industriellen Produkts, entspricht dem Ort, an dem mindestens 60 Prozent der Herstellungskosten anfallen.
2 Bei der Berechnung nach Absatz 1 werden berücksichtigt:
- die Kosten für Fabrikation und Zusammensetzung;
- die Kosten für Forschung und Entwicklung;
- die Kosten für gesetzlich vorgeschriebene oder branchenweit einheitlich geregelte Qualitätssicherung und Zertifizierung.
3 Von der Berechnung nach Absatz 1 sind ausgeschlossen:.
- Kosten für Naturprodukte, die wegen natürlichen Gegebenheiten nicht am Herkunftsort produziert werden können;
- Kosten für Rohstoffe, die gemäss einer nach Artikel 50 Absatz 2 erlassenen Verordnung aus objektiven Gründen am Herkunftsort nicht in genügender Menge verfügbar sind;
- Verpackungskosten;
- Transportkosten;
- die Kosten für den Vertrieb der Ware, wie die Kosten für Marketing und für Kundenservice.
4 Die Herkunftsangabe muss ausserdem dem Ort entsprechen, an dem die Tätigkeit vorgenommen worden ist, die dem Produkt seine wesentlichen Eigenschaften verliehen hat. In jedem Fall muss ein wesentlicher Fabrikationsschritt an diesem Ort stattgefunden haben.