Die NZZ AM SONNTAG greift heute den Vergewaltigungsfall am Bündner Verwaltungsgericht auf und fragt sich, wo eigentlich das schriftlich begründete Urteil bleibt. Gemäss Art. 84 Abs. 4 StPO muss das Gericht das schriftliche Urteil innerhalb von 60 Tagen, bei besonders komplexen Fällen nach 90 Tagen zustellen. Nur: Das Urteil ist dieses Wochenende 200 Tage überfällig.
In der NZZ AM SONNTAG verstecken sich die drei verantwortlichen Richter Bettina Flütsch, Hermi Saluz und Paul Schwendener hinter Justizsprecher Stefan Schmid. Dieser rechtfertigt die Verzögerung in der Zeitung wie folgt: «Es handelt sich für das Regionalgericht Plessur um einen in Bezug auf Arbeitsaufwand, Komplexität sowie öffentliche Aufmerksamkeit aussergewöhnlichen Fall», so die NZZ AM SONNTAG.
Warum indes insbesondere die öffentliche Aufmerksamkeit zu Verzögerungen bei der schriftlichen Begründung führen soll, erscheint schwer verständlich. Medienanfragen werden von den drei Richtern nie beantwortet, sondern regelmässig an Sprecher Schmid abdelegiert, der seinerseits sowohl für die Regionalgerichte als auch für das Kantonsgericht spricht – was institutionell für sich problematisch erscheint, müsste doch die nächsthöhere Gerichtsinstanz als Kontrollinstanz über die unteren Gerichte die höchstmögliche Distanz und Unabhängigkeit wahren.
Aber wie könnte die grosse öffentliche Aufmerksam für den Fall sonst zu einer Verzögerung beim Schreiben der Urteilsbegründung sorgen? Nimmt sich das Regionalgericht Plessur besonders viel Zeit, weil es weiss, dass das Urteil von Juristen in der ganzen Schweiz gelesen werden wird? Wird deshalb sorgfältiger gearbeitet als in anderen Fällen? – Was allerdings eine genauso unerträgliche Vorstellung wäre. Die Anwort Schmids in der NZZ AM SONNTAG wirft auf jeden Fall mehr Fragen auf, als sie beantwortet.
Eine reine Schutzbehauptung?
Auch das Argument, der Fall sei in Bezug auf Arbeitsaufwand und Komplexität besonders hoch, wird von Strafrechtlern aus dem Rest der Schweiz als reine Schutzbehauptung bezeichnet. Die NZZ AM SONNTAG zitiert dazu Strafverteidiger, Rechtsanwalt und Blog-Betreiber Konrad Jeker: «Eigentlich geht es zu diesem Zeitpunkt nur noch darum, die mündlich bereits kurz erläuterten Urteilsgründe im Einzelnen noch schriftlich auszuführen. Die grundsätzlichen Überlegungen sind bereits angestellt, die Kriterien definiert, das Urteil gefällt.»
Tatsächlich können auch andere, von INSIDE JUSTIZ befragte Strafrechtler nicht ausmachen, was an dem Fall besonders komplex sein soll. Sie nennen andere Beispiele von tatsächlich komplexen Fällen, z.B. den Raiffeisen-Komplex um die Hauptbeschuldigten Pierin Vincenz und Beat Stocker, in dem mehrere Sachverhalte mit mehr als einem halben Dutzend Beschuldigten aufgearbeitet und der behauptete Tatbeitrag jedes Einzelnen genau abgeklärt werden muss – und wo sich neuartige rechtliche Fragen stellen. Oder das damalige Strafverfahren gegen die Swissair-Verantwortlichen, wo es galt, eine äusserst verschachtelte Firmenstruktur aufzubrechen mit Dutzenden von Verantwortungsträgern, deren Entscheide im Hinblick auf eine allfällige strafrechtliche Relevanz zu überprüfen waren.
Im vorliegenden Falle ist das alles nicht gegeben: Es handelt sich anders als behauptet um einen einfachen Fall mit einem Opfer und einem Täter, dessen Urteil nicht einmal 60 Tage benötigen dürfte, wie verschiedene angefragte Juristen gegenüber INSIDE JUSTIZ bestätigen. Einer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will: «Wenn die drei Richter schon mit diesem Fall überfordert sind, möchte ich nicht wissen, wie dort bei wirklich komplizierten Fällen Recht gesprochen wird.»
Fatale Folgen
Wie die NZZ AM SONNTAG weiter schreibt, sind die Folgen der Schlamperei in vielerlei Hinsicht fatal. Jeker macht darauf aufmerksam, dass eine Strafe für den Verurteilten immer weniger Sinn ergebe, je länger die Tat zurückliege. Und nicht nur das: Gemäss ständiger Praxis des Bundesgericht ergibt ein Verstoss gegen das Beschleunigungsgebot einen zwingenden «Strafrabatt» – will heissen: Ein Täter hat eine gute Chance, dass seine Strafe reduziert wird, wenn ein Verfahren länger andauert und Staatsanwaltschaft und Gerichte gegen das Beschleunigungsgebot aus Art. 29 Abs. 1 der Bundesverfassung verstossen. Gerade die Opfer von Sexualdelikten berichten immer wieder davon, dass sie diesen Umstand als besonders stossend empfinden. Während sie oft lebenslang mit dem Folgen der Traumatisierung zu kämpfen haben, kommt der Täter am Ende mit einer Sanktion davon, die ihrem Rechtsempfinden komplett widerspricht – und nicht nur ihrem, sondern auch dem breiter Teile der Bevölkerung.
Im vorliegenden Falle hatte das Regionalgericht den Vergewaltigungsrichter zwar schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von 23 Monaten und einer Geldstrafe von CHF 5‘400 verurteilt. Allerdings: Freiheitsstrafen von unter 24 Monaten werden nicht vollzogen, sondern auf Bewährung ausgesprochen – was vorliegend auch geschah, genau so wie auch bei der Geldstrafe. Verblieb am Ende noch eine Busse von CHF 2’300, die unbedingt ausgesprochen wurde. Mit anderen Worten: Der Richter, der gemäss dem Gericht seine Praktikantin vergewaltigt hat, wird für seine Tat keinen einzigen Tag im Gefängnis verbringen müssen, sollte das Berufungsgericht das Strafmass nicht deutlich verschärfen. Und sogar wenn das Obergericht eine solche Verschärfung beschliessen würde, müsste es gleich wieder einen Rabatt für das Verschlampen vor dem Regionalgericht Plessur einräumen.
Psychologische Aufarbeitung bis zum Verfahrensabschluss erschwert
Die fatalen Folgen der Verschleppung gehen aber noch weiter. Die NZZ AM SONNTAG macht auf einen Punkt aufmerksam, der in der Öffentlichkeit bislang wenig Aufmerksamkeit geniesst.
Die Zeitung wörtlich: «Besonders schwerwiegend ist eine Praxis im Umgang mit den Opfern. Oft wird ihnen geraten, vorläufig auf eine Therapie zu verzichten. Um in einem jahrelangen Prozess über mehrere Instanzen möglichst glaubwürdig auszusagen, müssen sie traumatisiert bleiben. Ebenso will man verhindern, dass die Erinnerungen durch Therapiegespräche verändert werden.» Davon sei auch das Opfer in dem vorliegenden Falle betroffen. Gemäss NZZ AM SONNTAG sei die Frau umgezogen und habe sich abseits von Chur ein neues Leben aufbauen müssen.
Darüber hinaus spricht die Literatur von der Problematik der Retraumatisierung: Statt mit der Tat abschliessen zu können, würden die Opfer bei jeder Aussage vor einer neuen Gerichtsinstanz wieder auf die schlimmen Erinnerungen zurückgeworfen. Solche Re-Traumatisierungen könnten schlimmste Folgen bis hin zur Suizidalität haben.
Negative Signalwirkungen
Die Signalwirkung solcher Prozesse wird von Frauenrechtsorganisationen und Juristen seit vielen Jahren kritisch gesehen. Immer wieder wird die Vermutung geäussert, dass viele Opfer eine Sexualstraftat nicht anzeigen, weil Beispielfälle wie der vorliegende ihnen signalisieren, dass sie nicht ernstgenommen und die Justiz nicht in der Lage oder willens ist, ihnen so etwas wie Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Die NZZ berichtete am 25. Juli 2022, «65 Prozent der Verfahren werden von der Staatsanwaltschaft eingestellt, mehrheitlich, weil die Opfer keine Aussagen mehr machten oder ihr Desinteresse erklärten.»
Gerade in der Strafjustiz ist aber auch schon der schiere Umstand, dass sich ein Gericht nicht an gesetzliche Vorgaben hält und sowohl Beschleunigungsverbot wie gesetzliche Fristen missachtet, ein schlimmes Signal: Wie soll ein Beschuldigter eine Strafe für einen Verstoss gegen das Gesetz akzeptieren, wenn das Gericht, das die Strafe ausspricht, sich selbst nicht ans Gesetz hält?
***
Dass die Bündner Justiz es nicht schafft, ordentlich zu arbeiten, ist notorisch. Die langen Verfahrenszeiten vor Kantonsgericht hatten schon vor Jahren zu einer Expertenuntersuchung geführt. Sie kam zum Schluss, dass es immer mehr Verfahren gebe und diese immer komplexer würden, es gebe zu wenige Richter, um die Pendenzen abzuarbeiten. Eine der Empfehlungen: Die Teilzeitrichter abschaffen. Verwaltungs- und Kantonsgericht wurden in der Folge zu einem Obergericht zusammengelegt, die Richter wurden mit einem neuen Justizpalast belohnt, für dessen Herrichtung die Stimmbevölkerung am 27. November 2022 CHF 30 Mio. sprach. Wohl in der Hoffnung, damit die Missstände zu beenden.
Wie der Fall um die frühere Praktikantin zeigt, die – ausgerechnet – am Verwaltungsgericht von einem Richter vergewaltigt worden war, gehen die Probleme aber tiefer. Auch auf der ersten gerichtlichen Ebene, den Regionalgerichten, können es die Bündner nicht. Dass die drei Teilzeit-Richter Bettina Flütsch, Paul Schwendener und Hermi Saluz es noch immer nicht geschafft haben, bald ein Jahr nach der Hauptverhandlung das schriftlich begründete Urteil zuzustellen, lässt sich durch nichts rechtfertigen. Und schon gar nicht durch die billigen Ausreden, die sie durch den zu bedauernden Bündner Justizsprecher ausrichten lassen. Seine Stelle war übrigens auch im Rahmen der Justizreform geschaffen worden, um «mehr Transparenz zu schaffen» in den verschiedenen Fällen.
Das Vorgehen ist umso unverständlicher, als dem Spruchkörper spätestens angesichts der vielen Medienschaffenden bei der Hauptverhandlung hätte bewusst werden müssen, dass die Augen des gesamten Landes auf die Bündner Justiz gerichtet sind. Grund dafür ist nicht nur die aussergewöhnliche Konstellation, dass ausgerechnet ein Richter der höchsten kantonalen Gerichtsbarkeit der Vergewaltigung angeklagt war. Grund für diese Beachtung ist mindestens genauso sehr, dass die Bündner Justiz schon vor der Hauptverhandlung viele Indizien für die Befürchtung lieferte, dass in diesem Verfahren mit anderen Ellen gemessen würde, weil der Beschuldigte «einer der ihren» ist. Und der Beschuldigte selbst hatte es gemäss dem Opfer ja gesagt: «Als Richter bin ich in Graubünden unantastbar.»
Das begann mit der Voruntersuchung durch die Staatsanwältin Corina Collenberg, die mit dem Beschuldigten auf «Du» ist, die wichtige Beweiserhebungen unterliess, den Beschuldigten mit Samthandschuhen anfasste, monatelang untätig blieb und erst in die Gänge kam, als INSIDE-JUSTIZ über den Fall berichtete. Es ging weiter mit den Entscheiden des Kantonsgerichts, das keine Anhaltspunkte für Befangenheit erkannte, als ein Richter in den Ausstand treten wollte, weil er den Beschuldigten kannte und auch der Meinung war, das Hauptverfahren könne durchaus an dem Regionalgericht Plessur stattfinden, obwohl das in der engen Churer Juristenwelt tätig ist, wo ja auch der beschuldigte Richter praktizierte – und heute als Anwalt tätig ist. Es ging weiter mit dem Spruchkörper, in dem mit Hermi Saluz ein Richter der CVP/Mitte-Partei mitwirkt. Derselben Partei also, dessen Ortsparteipräsident der Beschuldigte in früheren Zeiten war. Eben dieser Richter war es dann auch, dessen Verhalten zu einer spontanen Demonstration und Rücktrittsforderungen in Chur führte, nachdem er das Opfer während der Hauptverhandlung fragen liess, warum es denn nicht einfach die Beine zusammengepresst habe, weil es dann – seiner Erfahrung gemäss – für einen Mann unmöglich gewesen wäre, in sie einzudringen.
Und als ob das nicht schon der Pleiten und Pannen genug gewesen wären, erlauben sich jetzt die Richter Flütsch, Saluz und Schwendener auch noch, bei der Zustellung des schriftlichen Urteils die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen der Strafprozessordnung und das Beschleunigungsgebot aus der Bundesverfassung zu missachten. Auch das natürlich wieder, was für ein Zufall, einzig zugunsten des Beschuldigten. Quod erat demonstrandum.
Die Verwahrlosung des Rechtsstaates in Graubünden kennt wahrlich keine Grenzen.
Titelbild: Was ist eigentlich los mit dem Regionalgericht Plessur – Wird da auch gearbeitet? (Karikatur: KI)
Ist die vorsitzende Richterin Bettina Flütsch überfordert?

Bettina Flütsch, Jahrgang 1980, stammt aus Luzern und hat an der dortigen Universität Rechtswissenschaften studiert. Während des Studiums trat sie mehrfach in Moot-Court-Wettbewerben auf. 2008 schloss sie mit dem Master of Law ab, bereitete sich anschliessend auf ihre Zulassung als Rechtsanwältin vor, unter anderem als Substitutin einer Anwaltskanzlei oder mit einem Auditorat am Kreisgericht See-Gaster im Kanton St. Gallen. 2011 wurde sie als Urkundsperson und Rechtsanwältin zugelassen, 2012 begann sie ihre Laufbahn als Staatsanwältin im Kanton Schwyz, wo sie es bis zur Abteilungsleiterin brachte. 2020 trat sie als Rechtsanwältin bei der Anwaltskanzlei Urs Huber ein.
Als Staatsanwältin in Schwyz machte sie bereits in einem heiklen Verfahren landesweit Schlagzeilen: Ein Schwyzer Kantonspolizist hatte auf der Ibergeregg einen unbewaffneten Einbrecher erschossen. Flütsch beantragte eine Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren wegen vorsätzlicher Tötung. Das Gericht sah es anders und verurteilte den Beamten wegen fahrlässiger Tötung zu lediglich 15 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung. Man warf Flütsch damals mangelndes Augenmass und eine Tendenz zur Überhärte vor.
Seit 2021 ist Flütsch ausserordentliche Richterin am Regionalgericht Plessur in Chur, zuletzt offiziell gewählt für die Amtsperiode 2025–2028. Ihr aktuelles 60-Prozent-Pensum ist bis Juli 2026 befristet. Ihr Einsatz sollte helfen, den massiven Pendenzenberg des Gerichts abzutragen. Doch ausgerechnet unter ihrem Vorsitz steckt eines der prominentesten Verfahren der jüngeren Justizgeschichte fest: der Prozess gegen einen ehemaligen Verwaltungsrichter, der wegen sexueller Übergriffe auf eine Praktikantin verurteilt wurde. Das Urteil erging im November 2024 – doch zehn Monate später liegt das schriftliche Urteil noch immer nicht vor.
Als die Bündner Kommission für Justiz und Sicherheit Flütsch 2021 zusammen mit zwei weiteren Richterinnen und einem Richter erstmals mit einem Teilzeitpensum anstellte, schrieb der damalige Kommissionspräsident Gian Derungs: «Der Kommission ist wichtig, dass sich die Bündner Justiz nebst einer guten Qualität der Urteile auch durch zeitnahe Entscheide auszeichnen kann, um den Rechtssuchenden möglichst rasch Rechtssicherheit zu bieten. Mit der Zuwahl der Richterinnen und des Richters für zwei Jahre verbindet sie aber auch die klare Erwartung, dass die Anzahl der pendenten Fälle spürbar verringert werden kann.»
Roger Huber / Lorenzo Winter
Der Fall: Darum geht es
Am Abend des 13. Dezember 2021 ruft der Verwaltungsrichter seine Praktikantin ins Büro. Dort wird er, so die Anklageschrift, schnell zudringlich. Er drückt die Praktikantin an die Wand und dringt in sie ein. So die Darstellung des mutmasslichen Opfers. Die junge Frau geht anschliessend für eine Untersuchung ins Spital, wo man in ihrem Genitalbereich die DNA des mutmasslichen Täters findet. Dieser behauptet, die Intimitäten seinen einvernehmlich passiert.
Drei Monate später erstattet das Opfer Strafanzeige. Der Beschuldigte wird einen Monat später, am 30. März 2022, zu einer polizeilichen Befragung vorgeführt.
Am 10. Dezember 2022 berichtet INSIDE JUSTIZ erstmals über den Fall, nachdem seit dem März keine relevanten Untersuchungshandlungen mehr geschehen waren. Im Zuge der Recherchen wird bekannt, dass die untersuchende Staatsanwältin Corina Collenberg mit dem Beschuldigten bekannt ist – sie dutzen sich. Eine ehemalige Lebenspartnerin des Beschuldigten arbeitet ebenfalls bei der Staatsanwaltschaft. Die SONNTAGSZEITUNG, die SÜDOSTSCHWEIZ und weitere Medien berichten ebenfalls. Der Fall wird landesweit bekannt. Experten kritisieren die fehlende Distanz und den fehlenden Strafverfolgungswillen der Staatsanwaltschaft.
Am 14. Dezember 2022 tritt der Beschuldigte schliesslich von seinem Amt als Verwaltungsrichter zurück.
Am 31. Oktober 2024, fast drei Jahre nach dem Delikt, findet am Regionalgericht Plessur die Hauptverhandlung statt. Dabei wird bekannt, dass der Beschuldigte sein Opfer und dessen Freund auch noch bedroht hatte. Als die beiden ihre Anwaltsprüfungen im Kanton hatten, schrieb der Beschuldigte sinngemäss, er habe dafür gesorgt, dass sie die Prüfung nicht bestehen würden. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten.
Am 5. November 2024 wird der Beschuldigte wegen der Vergewaltigung und der Drohung zu 23 Monaten Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe von CHF 5’400 verurteilt – beides bedingt. Bezahlen muss er hingegen eine Busse von CHF 2’300.— Franken. Der Verurteilte erklärt später die Berufung ans Bündner Obergericht. Das Regionalgericht Plessur muss damit innerhalb von 60 Tagen seit der mündlichen Urteilseröffnung ein schriftliches, begründetes Urteil an die Parteien nachreichen. Dieses Urteil ist bis zum heutigen Tage ausstehend.
Art. 84 StPO: Eröffnung der Entscheide
1 Ist das Verfahren öffentlich, so eröffnet das Gericht das Urteil im Anschluss an die Urteilsberatung mündlich und begründet es kurz.
2 Das Gericht händigt den Parteien am Ende der Hauptverhandlung das Urteilsdispositiv aus oder stellt es ihnen innert 5 Tagen zu.
3 Kann das Gericht das Urteil nicht sofort fällen, so holt es dies so bald als möglich nach und eröffnet das Urteil in einer neu angesetzten Hauptverhandlung. Verzichten die Parteien in diesem Falle auf eine öffentliche Urteilsverkündung, so stellt ihnen das Gericht das Dispositiv sofort nach der Urteilsfällung zu.
4 Muss das Gericht das Urteil begründen, so stellt es innert 60 Tagen, ausnahmsweise 90 Tagen, der beschuldigten Person und der Staatsanwaltschaft das vollständige begründete Urteil zu, den übrigen Parteien nur jene Teile des Urteils, in denen ihre Anträge behandelt werden.
5 Die Strafbehörde eröffnet einfache verfahrensleitende Beschlüsse oder Verfügungen den Parteien schriftlich oder mündlich.
6 Entscheide sind nach den Bestimmungen des eidgenössischen und kantonalen Rechts anderen Behörden, Rechtsmittelentscheide auch der Vorinstanz, rechtskräftige Entscheide soweit nötig den Vollzugs- und den Strafregisterbehörden mitzuteilen.
Art. 29 BV: Allgemeine Verfahrensgarantien
1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3 Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
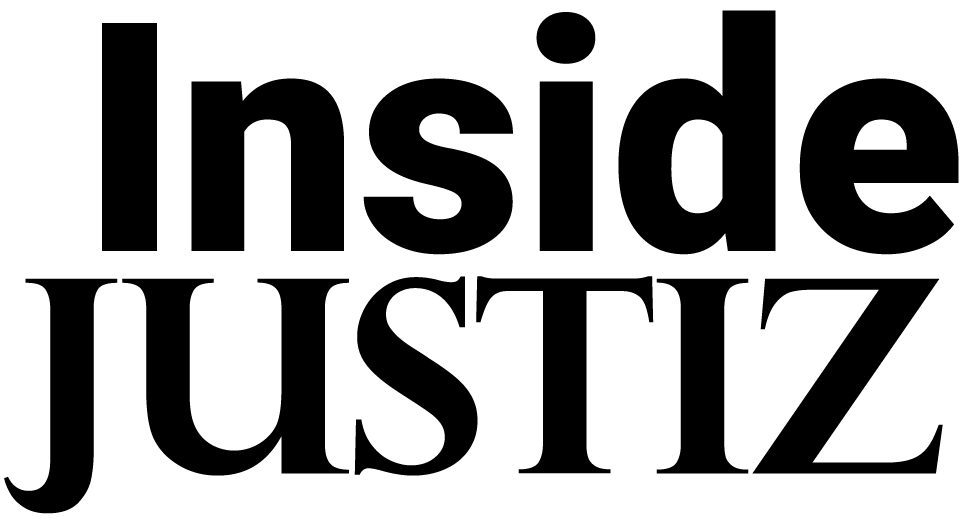
War überhaupt jemand von Inside Justiz bei der Hauptverhandlung dabei?
Der Chefredaktor persönlich.
Ein Problem dürfte sein, dass ein Laienrichter zwar seine Stimme geben kann, ein juristisch haltbares Urteil redigieren kann er aber nicht.
Das Justizopfer Adam Quadroni kann man unterstützen via Wolfgang Fiechtner Stiftung in Stein am Rhein. Danke.