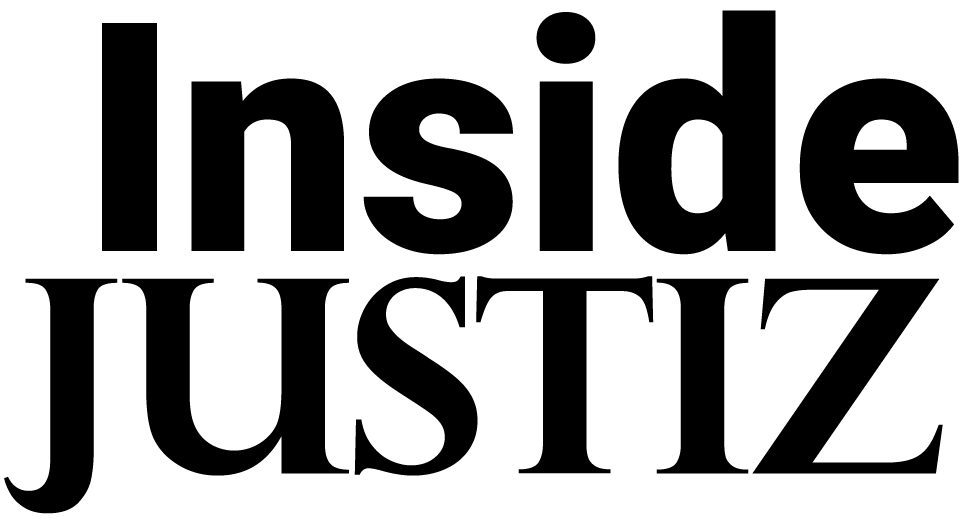Der Fall Christine Zwahlen – 1985 ermordet in Kehrsatz – hat sich tief in das kollektive Gedächtnis der Schweiz eingebrannt. Vierzig Jahre später ist der Justizskandal um ihren Ehemann Bruno Zwahlen nicht verklungen, sondern bleibt ein Symbol für mediale Dynamik, juristische Fehlleistungen – und eine Justiz, die am eigenen Anspruch scheiterte. Die jüngste Wiederaufnahme der Debatte durch die BERNER ZEITUNG und ZACKBUM.ch rückt zentrale Fragen erneut ins Licht: Hat die Justiz versagt? Und haben die Medien übersteuert?
Am 1. August 1985 wird die 24-jährige Christine Zwahlen tot in der Tiefkühltruhe ihres Hauses gefunden. Noch am selben Tag wird ihr Mann Bruno Zwahlen verhaftet. Zwei Jahre später erfolgt die Verurteilung wegen Mordes – ein Indizienprozess ohne eindeutigen Beweis. Doch 1993 wird er freigesprochen – aufgrund gravierender Verfahrensmängel. Der «Fall Kehrsatz» wird zum Kristallisationspunkt von Medienkritik, Justizreform und gesellschaftlicher Polarisierung.
Walter Däpp, damaliger Gerichtsreporter des BUND, spricht heute von einem «Netflix-artigen» Prozess. Tatsächlich nahm die öffentliche Wahrnehmung des Falls Dimensionen an, die ihresgleichen suchen.
Medien im Fokus: Aufklärung oder Kampagne?
Der Fall wurde zum medialen Grossereignis – national wie international. Bis zu 70 Journalisten berichteten während des Revisionsprozesses. DER SPIEGEL sprach von einer «Dorftragödie, die zu einem der grössten Justizskandale der Schweiz» wurde. Auch ARD, SRF und NZZ widmeten sich dem Fall wiederholt mit aufwändigen Reportagen, Dokumentationen und Talkformaten. Die Sendung «Der Stuhl» der «SRF RUNDSCHAU», in der Rechtsanwältin Trix Ebeling-Stanek als Studiogast auftrat, bleibt bis heute eine mediale Wegmarke in der Debatte um Gerechtigkeit und Wahrheitsanspruch.
Ebeling-Stanek war eine der wenigen Stimmen, die bereits früh auf massive strukturelle Defizite hinwiesen – und nicht davor zurückschreckten, die Täter-Opfer-Rhetorik der damaligen Medien infrage zu stellen. Ihre juristische Kritik betraf sowohl das Verfahren als auch die populistischen Mechanismen, die rund um den Fall entstanden. Petra Hartmann schreibt dazu auf ZACKBUM.ch: «Interessant war damals auch die mediale Hetze gegen RA Ebeling» – ein seltener, aber wichtiger Hinweis auf die einseitige Aufmerksamkeit, die dem Fall damals entgegengebracht wurde. (die beiden SRF Beitrag dazu finden sie hier und hier.)
Die Medien – mächtig, aber unkontrolliert?
Gerade in der medialen Dynamik zeigte sich, wie ein Fall entgleiten kann. Hanspeter Born, der mit seiner 17-teiligen Serie in der damals linksliberalen WELTWOCHE die Diskussion prägte, stilisierte Bruno Zwahlen vom mutmasslichen Täter zum Justizopfer. Sein erstes Buch «Mord in Kehrsatz» wurde ein Bestseller, das zweite «Unfall in Kehrsatz» gerichtlich verboten. Die Medienkampagne trug dazu bei, dass ein Unterstützungs-Komitee für Zwahlen gegründet wurde – Schulklassen sammelten über 1 000 Unterschriften.
Walter Däpp selbst räumt ein, dass die Medienberichterstattung wohl Einfluss auf die Geschworenen genommen haben könnte. Der mediale Druck war enorm – ein Effekt, der im heutigen digitalen Zeitalter durch soziale Medien wohl noch intensiver ausgefallen wäre.
Der Fall als Katalysator für Reformen – aber auch für Zynismus
Mit dem Freispruch Zwahlens endete nicht nur ein Prozess – es begann eine juristische Generalrevision: Das Geschworenensystem wurde in einigen Kantonen abgeschafft, die forensische Ausbildung reformiert, der Strafvollzug – etwa im Gefängnis Thorberg – hinterfragt. Bruno Zwahlen soll dort, wie eine Untersuchung ergab, unrechtmässige Privilegien genossen haben. Thorberg-Direktor Urs Clavadetscher musste 1993 zurücktreten.
Doch auch Zynismus hat sich breitgemacht. Auf Zackbum.ch kommentiert Peter Bitterli süffisant: «Es bleibt Borns ewiges Verdienst, den Toast Hawaii ein für alle Mal erledigt zu haben.» Gemeint ist das berüchtigte Gutachten zur letzten Mahlzeit des Opfers – das von einem Gerichtsmediziner erstellt wurde, der die Speise eigenhändig verspeiste und wieder erbrach, um sie zu analysieren.
Die Anwältin Trix Ebeling vertritt in ihrem Buch «Das Ende der Tage des Zweifels» die Ansicht, Zwahlen habe seine Frau mit einem Radmutternschlüssel erschlagen. Sie kam zu diesem Schluss, nachdem sie das Auto von Zwahlen erworben und festgestellt hatte, dass der Radmutternschlüssel ausgetauscht worden war. Eine rechtsmedizinische Begutachtung deutete zudem darauf hin, dass dieses Werkzeug sehr wahrscheinlich als Tatwaffe infrage kam. Dennoch lehnte der Berner Kassationshof einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens ab. Bis heute wurde kein anderer Täter überführt, und es bleibt umstritten, ob nicht doch der Ehemann für die Tat verantwortlich war.
2016 griff der Schriftsteller Peter Beutler den Fall in einem Kriminalroman erneut auf. Beutler vertritt die Auffassung, dass eine andere Person den Mord begangen habe – jedoch mit Wissen von B.Z. Wer auch immer der Täter war, er entging einer Bestrafung: Der Mordfall ist mittlerweile verjährt.
Ein Fall, der nie zur Ruhe kommt
Ob Bruno Zwahlen der Täter war oder nicht – diese Frage ist juristisch abgeschlossen, gesellschaftlich jedoch nicht. Sein Freispruch beruhte auf rechtsstaatlichem Zweifel, nicht auf erwiesener Unschuld. Der Mord an Christine Zwahlen ist bis heute ungelöst. Ihre Geschichte, ihre Person – sie bleiben auch im medialen Rückblick oft im Schatten des Mannes, der für ihre Ermordung verantwortlich gemacht wurde.
Rechtsanwältin Trix Ebeling-Stanek, Walter Däpp, Hanspeter Born, die vielen Kommentatoren und Leser – sie alle stehen für Perspektiven auf ein System, das mit Wahrheit ringt, aber nicht immer gerecht wird. Der Fall Zwahlen bleibt ein Lehrstück über den Einfluss von Medien, die Grenzen der Justiz und die unbequeme Erkenntnis, dass manchmal keiner weiss, was wirklich geschah.
(Titelbild Combo SRG/SRF: Oben links: Bruno Zwahlen, oben rechts: Hanspeter Born, unten links mit roten Haaren Trix Ebeling Stanek )
TV Spielfilm | 87 Minuten | Jahr
«Ein klarer Fall» – Rolf Lyssys zweite filmische Aufarbeitung des Falls Zwahlen
Der Film Ein klarer Fall (1995) ist die zweite filmische Bearbeitung des Justizfalls um den Berner Zahnarzt Bruno Zwahlen, der des Mordes an seiner Frau beschuldigt wurde. Regisseur Rolf Lyssy setzt auf Authentizität, indem er das Geschehen semi-dokumentarisch auf Grundlage von Prozessakten, Medienberichten und dem Buch Mord in Kehrsatz von Hanspeter Born inszeniert. Die Handlung wird aus der Perspektive eines fiktiven Journalisten, Loosli, erzählt, der als Ich-Erzähler durch den Film führt. Anfänglich scheint alles gegen den Angeklagten zu sprechen: Lebensversicherung, Eheprobleme, Blutspuren – der Fall scheint klar. Für den Staatsanwalt kommt nur der Ehemann als Täter in Frage. Die Stiefeltern der Ermordeten verwickeln sich in Widersprüchen. Ein angeschlagener Gerichtsmediziner liefert ein Gefälligkeitsgutachten. Der Richter manipuliert die Einvernahmen und setzt die Geschworenen unter Druck. Ein angepasster Anwalt entdeckt sein Rechtsgefühl und verfeindet sich mit seinen Duzfreunden, dem Staatsanwalt und dem Richter. Der Ehemann erhält lebenslänglich. Geschworene rebellieren. Ein Journalist recherchiert bis der Prozess wiederholt werden muss. In „Ein klarer Fall“ erzählt „Schweizermacher“-Regisseur Rolf Lyssy wie angesehene Justizbeamte sich in ihren Vorurteilen verstricken und brave Bürger für das Recht auf die Barrikaden gehen. Die Verwandtschaft mit dem Fall Zwahlen ist nicht zufällig: als Vorlage für den Film diente Hanspeter Borns Tatsachenbericht „Mord in Kehrsatz“.
Bild unten: Ein klarer Fall: (links) Manfred Studer und (Mitte) Daniel Bill als Bruno Zwahlen