Der Glarner Landrat berät am heutigen Mittwoch über das Begnadigungsgesuch eines Treuhänders. Wird das Gesuch abgelehnt, muss er für 18 Monate ins Gefängnis. Während Begnadigungsgesuche in der Regel abgelehnt werden, wirft der vorliegende Fall ein zwielichtiges Licht auf die Glarner Justiz. Dies ist der Start unserer Serie über die überforderte Justiz eines Innerschweizer Kantons. (Mitarbeit: Lorenzo Winter)
Kopfschütteln löst zunächst die Verfahrensdauer aus. Der Tatbestand, für den der Treuhänder einsitzen soll, liegt sagenhafte 20 Jahre zurück! In den Jahren Jahr 2004 bis 2006 soll der Treuhänder Kopf einer Betrugsmasche gewesen sein. Das Schema: Bei verschiedenen Firmen mit Sitzen in Graubünden, Zürich, Zug und Basel-Landschaft wurden angebliche Arbeitsverhältnisse begründet. Eine der Firmen, die damalige Logodome GmbH, hatte ihren Sitz in Näfels im Kanton Glarus, weshalb der Kleinstkanton am Ende die verschiedenen Verfahren führte.
Die Firmen in diesem Betrugsmuster gingen regelmässig nach kurzer Zeit Konkurs, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machten bei den Arbeitslosenkassen sog. Insolvenzentschädigungen geltend – also Entschädigungen für Löhne, welche ihnen von den konkursiten Firmen nicht (mehr) bezahlt werden konnten. Tatsache war aber auch: Die Mitarbeiter hatten zwar allesamt Arbeitsverträge unterschrieben, für die Firmen gearbeitet hatten sie allerdings nie – die Firmen gingen jeweilen bereits Konkurs, bevor überhaupt Aufträge an Land gezogen worden waren. Sofern das je die Absicht gewesen war. Denn tatsächlich wurden regelmässig Personen angestellt mit Berufsprofilen, die zu den Unternehmenszwecken passten wie die Faust aufs Auge. Etwa, wenn eine Pflegefachfrau für eine Event-Firma angestellt wurde.
Insolvenzanträge bei mehreren Arbeitslosenkassen
Insgesamt wurden nach dem besagten Schema Insolvenzentschädigungen von rund CHF 1,9 Mio. unrechtmässig beantragt; davon wurden knapp CHF 400’000.– tatsächlich ausbezahlt, bevor die Sache aufflog.
In der nachfolgenden Strafuntersuchung zeigte sich, dass es sich bei vielen der angeblichen Angestellten – teilweise auch bei solchen, die Geschäftsleitungsfunktionen innehatten – um einfache und bislang unbescholtene Personen handelte, die aus allen Wolken fielen, als ihnen plötzlich juristisches Ungemach drohte: Gleichwohl wurden sie verurteilt, weil sie in einer Notlage und in der Hoffnung, Beschäftigung zu finden, einen Arbeitsvertrag unterschrieben hatten und später ein Gesuch um Insolvenzentschädigungen, das sie nicht verstanden hatten und das ihnen von einer Vertrauensperson vorgelegt worden war. Verschuldensstrafrecht? Mitnichten. Doch die Glarner Urteile wurden vom Bundesgericht später bestätigt.
Die drei Drahtzieher
Besagte Vertrauenspersonen, das waren insbesondere Harry K., Alfred B. und Samuel S. Sie werden in den Verfahrensakten als «Drahtzieher» bezeichnet und erhielten denn auch die höchsten Strafen: 34 Monate für Harry K., 32 Monate (davon 16 bedingt) für Alfred B., 26 Monate (davon 14 bedingt) für Samuel S. – Teilweise wurden dabei allerdings noch bedingte Strafen aus früheren Verfahren angerechnet – im Falle von Harry K. unkorrekterweise, wie das Bundesgericht festhielt.
Wichtig: Um den Treuhänder, von dem diese Geschichte eigentlich handelt, ging es in allen diesen Verfahren nie. Beziehungsweise nur am Rande: Er wurde zwar 2006 einmal als Beschuldigter einvernommen, danach allerdings nie strafrechtlich verfolgt und blieb Auskunftsperson.
Die Glarner Justiz sah in dem Treuhänder zunächst lediglich einen externen Dienstleister, der allerdings direkt oder indirekt in verschiedensten Auftragsverhältnissen für die inkriminierten Gesellschaften tätig war – in dem einen Fall war als Beauftragter einer der Firmen in die Kursabwicklung involviert und/oder hatte ein Mandat für die Buchführung, in anderen Fällen vertrat er die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Arbeitslosenkasse bei der Eingabe für die Insolvenzentschädigungen.
Die wundersame Wende oder das unmögliche Vorgehen des SVP-Richters Rüedi
Das änderte sich erst am 9. November 2012 – dann aber gleich in einer dramatischen Wende. Damals sollte das Glarner Obergericht unter dem Vorsitz von Kantonsgerichtspräsident Yves Rüedi (grosses Bild links) eigentlich in einem anderen Fall verhandeln. Vor Gericht standen damals zwei der bereits Bekannten: Harry K. und Samuel S., dazu der besagte Treuhänder. Die Vorwürfe in diesem Verfahren: Betrug und Urkundenfälschung. Und dieses Mal mitbeschuldigt: Der besagte Treuhänder, der auch der Geldwäscherei beschuldigt war.
Geschichte schreibt der Prozesstag dann allerdings nicht wegen des eigentlich traktandierten Prozessthemas. Sondern, weil Obergerichtspräsident Rüedi, unterdessen Bundesrichter für die SVP, aus dem Nichts einen ganzen Fragekatalog nicht zu dem eigentlichen Prozessthema hervorzaubert, sondern zu dem längst abgeschlossenen Fall des Logodome-Komplexes. Ein mutmasslich einmaliges und rechtsstaatlich eigentlich unmögliches Vorgehen von Rüedi, das bis heute nie richtig aufgearbeitet wurde. Als einzige Konsequenz bliebt, dass Rüedi schliesslich wegen Befangenheit aussortiert wurde. Beobachter des damaligen Verhandlungstages sprechen bis heute abwechslungsweise von einem «abgekarteten» oder einem «unwürdigen Spiel».
Die Verhandlung endet damit, dass der besagte Treuhänder aus dem Gerichtssaal heraus verhaftet und für zehn Tage in Untersuchungshaft versetzt wird. Nein, nicht wegen der Geldwäscherei-Vorwürfe. Dieses Verfahren wird später nach einigem Hin- und Her vom Bundesgericht eingestellt. Dem Treuhänder wird nun plötzlich vorgeworfen, er sei in der Insolvenzsache des Logodome-Komplexes der eigentliche Drahtzieher gewesen. Es finden Hausdurchsuchungen statt, Speziell: eine Einvernahme des Beschuldigten bringt die Glarner Staatsanwaltschaft hingegen während der gesamten zehntägigen Untersuchungshaft nicht zustande. Der Treuhänder wird aus der Untersuchungshaft entlassen, ohne auch nur ein einziges Mal befragt worden zu sein.
Belastende Aussagen
Der Hintergrund der Aktion: Samuel S. und Harry K., zwei der drei rechtskräftig verurteilten Drahtzieher aus dem Insolvenzentschädigungs-Betrug, belasten neuerdings den Treuhänder, er sei der grosse «Pate» im Hintergrund gewesen. Die Glarner Staatsanwaltschaft, offenkundig überfordert, lässt durch die Regierung den Rechtsanwalt Thomas Bossard (grosses Bild rechts) eine Untersuchung gegen den Treuhänder führen.
Insbesondere Harry K. und Samuel S. behaupten in der Voruntersuchung, der Treuhänder habe das ganze Betrugsschema ausgeheckt, und nicht nur das: Von den Geldern, die man von den Arbeitslosenkassen abziehen wollte (und die z.T. ja auch ausbezahlt worden waren), seien zu einem grossen Teil an den Treuhänder geflossen. Eine Aussage, die sich bis heute nie beweisen liess. Auch die Einvernahmen der verschiedenen Arbeitnehmer, die in dem Insolvenzentschädigungs-Verfahren verurteilt worden waren, erbringen keinerlei Hinweise auf eine (Mit-)Täterschaft des Treuhänders: Viele geben an, den Mann gar nicht zu kennen und nie getroffen zu haben. Dass sie ihm einen Teil der «Beute» hätten abgeben müssen, verneinen sie. Die Geldflüsse nachzuweisen, hält Staatsanwalt Bosshard nicht für nötig. Er – und später auch die Gerichte – verlassen sich auf die Aussage, die Gelder seien in bar geflossen. – Dass die Insolvenzentschädigungen, die ja auf ein Bankkonto der «Mittäter» überwiesen worden waren, dann ja aber irgendwann von deren Konten hätten abgehoben werden müssen? Geschenkt!
Interessant auch: Harry K., der den Treuhänder in dem gesamten Verfahren zuvor nie belastet hatte, wird inzwischen von einem neuen Anwalt vertreten. Aus dem Motiv, warum er plötzlich ganz anders aussagt, macht er kein Geheimnis. In einer Einvernahme vom 15. Januar 2015 räumt er offen ein: «Ich denke aufgrund dieser neuen Tatsachen könnte ich dann in Revision gehen.» Anderen der bereits verurteilten Mittäter gegenüber erzählt Harry K., es sei seine Absicht, den Treuhänder ins Gefängnis zu bringen – dazu bedrängt er sie auch, wider besseres Wissen belastende Aussagen gegen den Treuhänder zu tätigen. Und das nicht nur einmal. Alfred B., ein anderer der drei Drahtzieher aus dem Insolvenzbetrug, sagt das schon zu Beginn der Untersuchung so aus. Nur: Seine Aussage wird ignoriert, Staatsanwalt Bosshard und später auch die Gerichte schiessen sich vollkommen auf den Treuhänder ein.

Die Richter des Entscheides vor dem Kantonsgericht. (oben links) Andi Kreis, (unten links) Christoph Zürrer, (mitte) Max Widmer, (oben rechts) Ursula Ebner (SVP), und (unten rechts) Ursula Schwab (SVP).

Das Obergericht in der Zusammensetzung: (oben rechts) Mario Marti, (oben mitte) Obergerichtspräsidentin Petra Hauser, (mitte unten) Monika Trümpi, (oben rechts) , André Pichon und (unten rechts)
Die Glarner Gerichte und die StPO-Fristen
Die erstinstanzliche Hauptverhandlung des Kantonsgerichts Glarus findet schliesslich am 13. September 2018 statt, muss aber zur Klärung der Vorfragen vertagt werden und wird schliesslich am 12. Februar 2019 fortgesetzt – in der Besetzung Max Widmer, Erika Schwab, Ursula Elmer, Christoph Zürrer und Andreas Kreis. Seit der Eröffnung der Voruntersuchung sind zu diesem Zeitpunkt bemerkenswerte sechs Jahre und drei Monate vergangen. – Und das in einem Fall, der ja bereits einmal abgeschlossen war mit der früheren Verurteilung der involvierten Personen. Das erstinstanzliche Verfahren endet – bis auf wenige Monate 15 Jahre nach den Taten und damit ultraknapp vor Eintritt der Verfolgungsverjährung – mit einem Schuldspruch gegen den Treuhänder wegen gewerbsmässigen Betrugs. Das Strafmass: Eine Freiheitsstrafe von 42 Monaten. Schon hier braucht das Gericht fast vier Monate für das Urteil.
Das Obergericht Glarus bestätigt am 24. Juni 2022 im Wesentlichen den Schuldspruch, reduziert die Strafe aber auf 36 Monate (18 davon unbedingt) – Besetzung: Petra Hauser, Monika Trümpi, André Pichon, Mario Marti und Ruth Hefti. Auffällig: Wieder benötigt das Gericht eine lange Zeit für die Urteilsberatung Die Berufungsverhandlung hatte bereits am 24. März 2021 stattgefunden, bis zum schriftlich begründeten Urteil vergingen sagenhafte 15 Monate. Nachvollziehbare Gründe für diese Verzögerung sind nicht ersichtlich. Noch gravierender ist, dass die schriftliche Urteilsbegründung den Parteien gar erst im August 2023 zugestellt wurde – ganze 29 Monate nach der Berufungsverhandlung. Ein Beobachter merkt sarkastisch an: «Das Gericht benötigte 15 Monate bis zum Erlass des Dispositivs und insgesamt schlappe 29 (!) Monate bis zur Zustellung des schriftlichen Urteils. – Wow!» Das Bundesgericht wiederum wird später zwar festhalten, das Beschleunigungsverbot sei verletzt, winkt das windige Glarner Urteil aber mit dem Verweis durch, die Verteidigung habe ja auch mehrfach auf Zeit gespielt.
Dabei hat das Glarner Obergericht unter der Obergerichtspräsidentin Petra Hauser klar gegen Art. 84 Abs. 4 StPO verstossen, die da lautet: «Muss das Gericht das Urteil begründen, so stellt es innert 60 Tagen, ausnahmsweise 90 Tagen, der beschuldigten Person und der Staatsanwaltschaft das vollständig begründete Urteil zu.» Nur: Die gesetzliche Frist ist eine Ordnungs- und keine Verwirkungsfrist, sodass sich die Gerichte nahezu jede Frist genehmigen können. Der Strafrechtler und Rechtsanwalt Konrad Jeker hat dazu kürzlich in seinem Blog (www.strafprozess.ch) die etwas provokative Bemerkung gesetzt, wonach sich der Gesetzgeber solche Fristsetzungen im Grund schenken könne – eine Verletzung der Frist habe ja sowieso keine Sanktionen der verantwortlichen Richterinnen und Richter zur Folge.
Fragwürdige Beweiswürdigung
Aber auch in materieller Hinsicht wirft die Arbeit der Glarner Richterinnen und Richter viele kritische Fragen auf – und erweckt bisweilen den Eindruck, dass hier primär gegen einen Beschuldigten entschieden wurde, weil dieser in dem gesamten Verfahren beharrlich geschwiegen hatte – was aber letztlich sein gutes Recht ist und – eigentlich – nicht gegen ihn ausgelegt werden dürfte. Es wäre immer noch am Staat, die Schuld eines Beschuldigten zu beweisen, und nicht umgekehrt.
So ist zum Beispiel der Entlastungszeuge Alfred B. trotz entsprechender Beweisanträge der Verteidigung nie direkt vor Gericht gehört worden. Dabei hatte Alfred B. mehrfach in Vernehmungen sowohl in der Schweiz wie auch auf dem Rechtshilfeweg in Vorarlberg – wo er unterdessen Wohnsitz hat – klar und widerspruchsfrei ausgesagt, dass Harry K. die treibende Kraft hinter dem Betrugsschema war. Und auch, dass Harry K. ihm gegenüber erklärt habe, «er wolle {den Treuhänder} inneriisse, der habe genug Geld, der können schon etwas bezahlen. (…) Er hatte damals gesagt, dass man {den Treuhänder} unter Druck setzen könne und dass dieser dann schon bezahle.»
Das Obergericht wischte die Aussagen des Entlastungszeugen ohne nachvollziehbare Begründung einfach vom Tisch. Auch für die Unterstellung des Gerichts, der Treuhänder habe die aufwändige Dokumentation und die Anträge auf Ausrichtung der Insolvenzentschädigungen erstellt und die Mittäter hätten lediglich als «Adlaten» ihre Unterschrift geleistet, gibt es keinerlei Beweise – weder in den Daten, die bei zwei Hausdurchsuchungen sichergestellt worden waren, noch in den Einvernahmeprotokollen der bereits rechtskräftig verurteilten Arbeitnehmer, die keinerlei Aussagen in diese Richtung machten, sondern klar festhielten, dass ihnen die Unterlagen nie vom Treuhänder, sondern z.B. von Alfred B. zur Unterschrift vorgelegt worden waren.
In Erscheinung getreten ist der verurteilte Treuhänder in allen Fällen erst in den darauffolgenden Verwaltungsverfahren, wo er gegenüber den Arbeitslosenkassen die Interessen der Arbeitnehmer vertrat. Treuhänderisch und nicht anders als ein Anwalt, der einen Ladendieb vertritt. Diese Rechtswahrnehmung macht weder einen Anwalt noch wie hier den Treuhänder selbst zum Täter. Eigentlich. Ausser im Kanton Glarus.
Nachtrag: Der Glarner Landrat hat an seiner Sitzung vom 27. August 2025 das Begnadigungsgesuch des Treuhänders mit 57:0 abgelehnt.
20 Jahre Verfahren, Millionen Kosten und ein verkorztes Urteil
Es ist später Abend in der Redaktion. Vor uns drei hohe Stapel mit Akten: Verfügungen, Protokolle, Urteile – Kantonsgericht, Obergericht, Bundesgericht. Auf den Klebezetteln stehen Zahlen und Schlagworte: „1,9 Mio. beantragt / 400’000 ausbezahlt“, „29 Monate bis zur Begründung“, „EM-Schwelle 12 Monate“. Wir haben tausende Seiten gelesen, Einvernahmen eines guten Dutzends Beteiligter studiert, Widersprüche markiert, Indizienketten nachgezogen. Ein Stoff, der locker eine ganze Netflix-Staffel füllen würde – nur: der buchhalterisch nachgewiesene direkte Geldfluss zum Treuhänder fehlt.
Das Bundesgericht schauten als letzte Instanz vor einigen Wochen unter der Leitung von (grosses Bild Mitte) Bundesrichterin Laura Jacquemoud-Rossari (Präsidentin, Die MItte), (Bilkd mitte links) Bundesrichter Giuseppe Muschietti (FDP) und (Bild mitte rechts) Bundesrichter Patrick Guidon (SVP) bei ihrem Entscheid – wie die Vorinstanzen – einfach darüber hinweg.
Die höchste Instanz anerkennt zwar die Verletzung des Beschleunigungsgebots, lässt aber die vorinstanzliche Indizienkette stehen und belässt es bei der bereits gewährten Strafminderung. Bleibt die Begnadigung im Glarner Landrat. Scheitert sie, tritt der Treuhänder den unbedingten Teil von 18 Monaten an – nach über zwanzig Jahren Verfahren.
Roger Huber
Sprengstoffalarm in Glarus?
Weitere Enthüllungen zur Glarner Justiz
In den kommenden Tagen berichten wir über weitere (unglaubliche) Details aus den laufenden Verfahren rund um den „Paten“ und die Glarner Justiz. Schon jetzt wird deutlich, wie teuer die Vorgänge für die Steuerzahler wurden. Alleine der ausserordentliche Staatsanwalt verursachte Kosten von satten 150’000 Franken.
Das Verfahren selber dürfte die Steuerzahler rund zwei Mio. Franken gekostet haben. Und die Kosten steigen weiter. Denn jeder künftige Tag im Gefängnis des „Paten“ kostet die Glarner Steuerzahler weitere 500 Franken.
Doch die eigentlichen Skurrilitäten spielen sich hinter den Kulissen ab: So mussten sich der als „Pate“ bezeichneter Treuhänder und sein Anwalt zum Beispiel auf polizeiliche Anordnung splitternackt ausziehen, weil ein angeblicher Sprengstoffanschlag vermutet wurde. Im Glarnerland?
Und was machen die anderen in diesem epischen Fall angeklagten Personen? Wer musste ins Gefängnis? Wer trat wieder in Erscheinung? Auch hier haben wir recherchiert.
Unsere Geschichten zeigen erneut eine überforderte (Glarner) Justiz die den Steuerzahler viel Geld und einem Treuhänder nun die Freiheit kostet.
Teil 1: Treuhänder soll mehr als 20 Jahre nach der Tat für 18 Monate ins Gefängnis
Teil 2: Kommentar: Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.
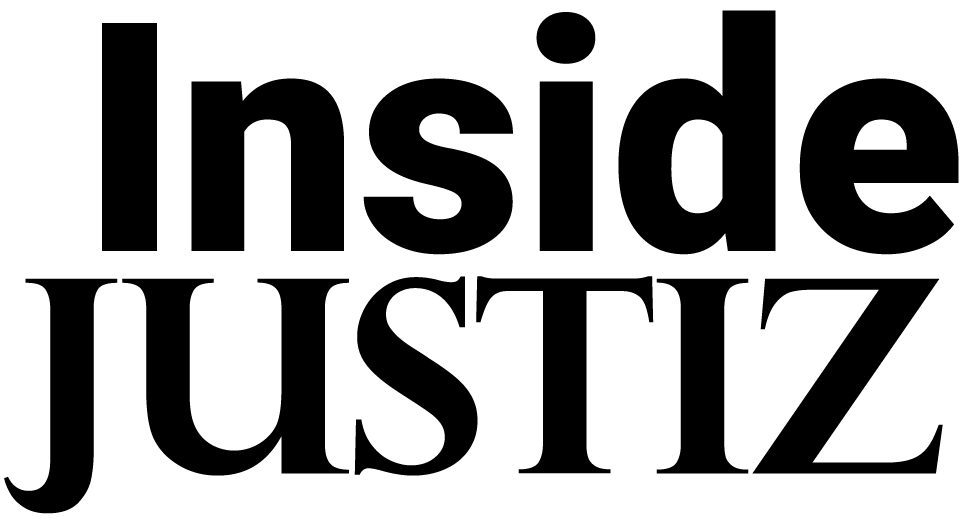
Gratuliere, eine sehr gute Recherchearbeit! Ich habe etwas gezögert einen Kommentar zu verfassen; ich habe mich aber nun trotzdem dazu entschlossen, weil ich will, dass die Wahrheit oder wenigstens ein Teil davon ans Tageslicht kommt. In der glarner Justiz läuft einiges nicht korrekt. Ich kenne den Fall von innen. Der Anwalt des betroffenen Treuhänders wurde die Akteneinsicht nicht normal gewährt, sondern erschwert. Normalerweise werden einem Anwalt die Gerichtsakten zugestellt, und dieser sendet nach Akteneinsicht die Akten an die Kanzlei zurück. In diesem Fall wurde dem Anwalt, der seine Praxis in der Stadt Zürich hat, die Akten aber nicht zugesandt. Der Anwalt musste für die Akteneinsicht extra nach Glarus fahren. Das hat mich erstaunt. Die Akteneinsicht fand unter Aufsicht einer Gerichtsmitarbeiterin statt, normalerweise darf ein Anwalt die Akten unbeaufsichtigt einsehen. Der Anwalt hat sich damals zu Recht aufgeregt, aber die internen Vorgaben mussten eingehalten werden. Ich verletzte keine Amtsgeheimnisse, wenn ich hier sage, dass das alles System hatte. Das Gericht war von Beginn der Untersuchung gegen den Anwalt und seinen Mandanten eingestellt. Ich würde die Behauptung wagen, der Mann hatte von Anfang an keine Aussicht auf ein faires Verfahren. Interessant wäre auch eine Recherche zu Erich Hug (Gerichtsschreiber), Yves Rüedi (ehemaliger Obergerichtspräsident und heutiger Bundesrichter), Max Widmer (ehemaliger Kantonsrichter) und Andrea Bettiga (ehemaliger Regierungsrat). Dank der Fürsprache von Andrea Bettiga wurde der ausseramtliche Staatsanwalt Thomas Bosshard für viel Geld mit der Strafuntersuchung beauftragt. Ich habe nie verstanden, warum Glarus diese Untersuchung nicht selbst geführt hat.
Landratsbeschluss 57:0 gegen die Begnadigung; das sagt alles. Ein zunull Entscheid ist bei der Breite der Parteienlandschaft sehr ungewöhnlich, ob da jemand im Hintergrund etwas vorgespurt hat?