Vor über 40 Jahren hatte das Bundesgericht festgehalten, dass die Schweizerische Steuergesetzgebung für Ehepaare verfassungswidrig sei. Grund: Bei Ehepaaren – anders als bei Konkubinatspaaren – wird das Einkommen zusammengezählt und gemeinsam versteuert. Das sei eine Diskriminierung, hielt das Bundesgericht in BGE 110 Ia 7 fest, und widerspreche Art. 4 der Bundesverfassung.
Wörtlich hiess es dort: «Ungleichheiten bei der Besteuerung sollten aber die Wahl, vor die sich immer mehr Paare gestellt sehen, nicht zuungunsten des Instituts der Ehe beeinflussen. Der Steuergesetzgeber hat daher sorgfältig darauf zu achten, dass die von Art. 4 Abs. 1 BV geforderte Rechtsgleichheit gewahrt bleibt und die Ehepaare nicht mehr Steuern bezahlen müssen als Konkubinatspaare mit gleichem Gesamteinkommen.»
Nur: Weil die Schweiz keine Verfassungsgerichtsbarkeit kennt, sondern die direkte Demokratie (mit dem Referendums- und Initiativrecht) höher gewichtet, muss das Bundesgericht Bundesgesetze anwenden, auch wenn es sie für verfassungswidrig hält. Lediglich bei kantonalen Erlassen kann das Bundesgericht korrigieren.
Hält das Bundesgericht eine Gesetzesbestimmung für verfassungswidrig, nimmt der Gesetzgeber den Ball in aller Regel auf und sucht nach einer verfassungskonformen Regelung, indem er die gerügte Bestimmung überarbeitet.
Im Falle der Heiratsstrafe hat dieser Prozess mehr als 40 Jahre gedauert – am Dienstag hat nun der Ständerat mit dem knappsten aller möglichen Resultate, nämlich mit 23:22 Stimmen, eine Gesetzesrevision verabschiedet, welche die Individualbesteuerung vorsieht.
Was es bedeutet
Ein einfaches Beispiel zur Veranschaulichung: Ein Paar in Zürich, beide 35 und ohne Kinder, verdient zusammen 180’000 Franken, 100’000 davon trägt die Frau bei, 80’000 der Mann. Aktuell werden die Einkommen des Paares zusammengerechnet, womit sie auf CHF 180’000 kommen. Macht eine Bundessteuer von CHF 9’287. Ohne Trauschein reichen beide eine Steuererklärung ein. Die Frau würde dann auf ihr Einkommen von CHF 100’000 eine Bundessteuer von CHF 2’688 bezahlen, der Mann für 80’000 Einkommen eine solche von CHF 1’381 – oder zusammen: CHF 4’069. Der Trauschein kostet dieses Paar also bei der Bundessteuer jedes Jahr CHF 5’218. (Zahlen: Steuerrechner des Bundes).
Zustande kommt diese Diskriminierung aufgrund der Steuerprogression. Also der Tatsache, dass nicht alle denselben Prozentsatz ihres Einkommens als Steuern abführen, sondern dieser Prozentsatz immer höher wird, je mehr jemand verdient. Juristisch nennt man das auch Besteuerung anhand der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Sprich: Wer mehr beitragen kann an die Allgemeinheit, soll das nicht nur absolut, sondern auch relativ tun.
Diese Progression wird mit der nun verabschiedeten Revision noch einmal gesteigert, d.h., wer viel verdient, wird prozentual noch einmal mehr an den Staat abdrücken müssen. Mit dieser Massnahme will das Parlament die Steuerausfälle etwas reduzieren: Ursprünglich sollten durch die Abschaffung der Heiratssteuer CHF 870 Mio. weniger in die Bundeskasse fliessen, wegen der verschärften Progression sollen es jetzt nur noch CHF 600 Mio. sein.
Abhilfe dank Individualbesteuerung
Das nun im Parlament verabschiedete Modell sieht vor, dass künftig auch Ehepaare nicht mehr eine, sondern zwei Steuererklärungen einreichen und so jeweils individuell besteuert werden. Der Zivilstand macht keinen Unterschied mehr. Die Indidivualbesteuerung entspricht damit einem vollkommenen Systemwechsel. Und: Der muss nun nicht nur auf Stufe Bund, sondern auch in den Kantonen vollzogen werden. Dafür haben die Kantone 10 Jahre Zeit – mit anderen Worten: Es dürfte also ein halbes Jahrhundert dauern, bis der verfassungswidrige Zustand, wie ihn das Bundesgericht 1984 festgestellt hatte, schliesslich korrigiert ist.
Viele Kantone stehen der Reform allerdings nach wie vor kritisch gegenüber und verweisen darauf, dass sie die Heiratsstrafe schon längst mit anderen Mitteln im Steuerrecht abgeschafft hätten. Zum Beispiel über andere Steuertarife, Abzugsmöglichkeiten, Freibeträge, usw. Inwieweit die Kantone Stimmung gegen die neue Regelung machen werden, bleibt deshalb abzuwarten.
Noch nicht ausgestanden
Denn: Ausgestanden ist die Angelegenheit noch längst nicht, insbesondere die Mitte und Kreise der SVP liebäugeln mit dem Referendum. Sie machen dafür verschiedene Argumente geltend, beispielsweise, dass die Individualbesteuerung das alte Ehemodell mit nur einem Verdiener benachteilige. ¨
Was nicht von der Hand zu weisen ist: Würde in unserem Beispiel etwa nur die Frau Einkommen erwirtschaften, und zwar die vollen CHF 180’000 und müsste dann eben zum Alleinstehenden-Tarif versteuern, wären nicht mehr CHF 9’287, sondern CHF 10’381 geschuldet.
Die Mitte und die SVP fürchten deshalb Benachteiligungen für Einverdiener-Familien. Und weisen auf den zusätzlichen Aufwand hin: Mit der Individualbesteuerung müssen Ehepaare zwei statt nur einer Steuererklärung einreichen – und diese müssen dann auch separat geprüft werden. Zudem könnten sich gerade bei Familien zusätzliche heikle Abgrenzungsfragen stellen, z.B. wie gemeinsames Eigentum und gemeinsame Hypothekarschulden – etwa Wohneigentum – dann auf die Vermögen der beiden Ehepartner aufgeteilt würden. Ähnliche Fragen stellten sich auch bei Kindergeld oder Kinderabzügen und anderen Posten der Steuererklärung.
***
Auch diese Woche war alles andere als klar, ob die Individualbesteuerung die Hürde im Parlament nehmen würde, das Resultat im Ständerat unglaublich knapp. Gleichwohl ist die Weichenstellung richtig und wichtig. Die Modelle des Zusammenlebens sind in den letzten Jahren immer vielfältiger geworden, eine Besteuerung jeder einzelnen Person trägt dem am besten Rechnung.
Dass das den konservativen Kräften der Mitte und der SVP nicht einleuchtet, ist schade. Anders als in anderen westlichen Ländern tun sich konservative Kreise in der Schweiz immer noch sehr schwer mit der Vorstellung, dass auch in einer Ehe mit Kindern beide Elternteile erwerbstätig bleiben. Dabei müsste längst auch diesen Kreisen klar werden, dass die Einverdiener-Ehe mit der Mutter, die zuhause bleibt, ein überholtes Modell ist und nur Nachteile mit sich bringt.
Es beginnt damit, dass es keinen Sinn macht, wenn die Gesellschaft enorme Mittel in die Bildung der Frauen investiert, diese sich dann nach wenigen Arbeitsjahren primär aufs Muttersein zurückziehen. Wenn wir es (zurecht) als Errungenschaft der Gleichberechtigung feiern, dass heute über 50% der Universitätsabgängerinnen Frauen sind, kann es nicht sein, dass diese bildungspolitische Investition dann einfach versandet.
Gerade die SVP hat hier ein dickes Argumentationsproblem: Wer wie sie weniger Migration will, sollte alles Interesse haben, dass Frauen mit ihren hervorragenden Ausbildungen dazu beitragen, dass der Fachkräftemangel nicht mit Migranten gelöst wird. Die Individualbesteuerung setzt hier die richtigen Anreize.
Weiter geht es beim Thema Scheidungsrisiko – das in der Schweiz immerhin rund 50% beträgt. Das Bundesgericht hat hier zuletzt das Signal gesetzt, dass es eine gescheiterte Ehe nicht weiter als finanzielle Lebensversicherung für die nichtarbeitende Ex-Frau anerkennt. Zudem entscheidet das Bundesgericht vermehrt, dass auch Väter im Trennungsfall an der Kinderbetreuung weiterhin einen höheren Anteil haben sollen.
Auch diese Rechtsentwicklung ist unter dem Gleichstellungsaspekt richtig und wichtig. Sie bedingt aber, dass Frauen nicht einfach 20 Jahre aus dem Arbeitsprozess ausscheiden, sonst wird es im Falle einer Scheidung schwierig, wieder Tritt zu fassen. Die Individualbesteuerung setzt einen Anreiz, dass auch in einer Ehe beide Ehepartner erwerbstätig bleiben, und das ist auch unter diesem Aspekt richtig.
Schliesslich zum Thema Altersarmut bei Frauen. Verursacht ist diese sehr oft dadurch, dass Frauen Erwerbsjahre in der Pensionskasse und/oder AHV fehlen, weil sie sich für das konservative Familienmodell entschieden hatten und aus dem Arbeitsleben ausgeschieden waren. Auch unter diesem Aspekt ist es richtig, dass die Steuerbelastung für Doppelverdiener-Ehepaare sinkt und damit ein Anreiz gesetzt wird, dass beide Ehepartner erwerbstätig bleiben. Damit kann auch die Altersarmut bei Frauen reduziert werden.
Fazit: Das Familienmodell, das die Gegner der Individualbesteuerung verteidigen wollen, bringt weder gesellschaftspolitische noch volkswirtschaftliche Vorteile. Im Gegenteil: Das zwanghafte Festhalten daran, dass kein Familienmodell bevorzugt werden dürfe, lähmt die Gesellschaft und lässt den Schweizer Wohlstand hinter andere Länder zurückfallen. Aber offenbar fehlt der Politik noch immer der Mut zu einem klaren Bekenntnis, dass das Schweizer Familienmodell im 21. Jahrhundert von zwei gleichberechtigten Partnern ausgeht, die beide erwerbstätig bleiben. Auf dieses Modell sollte dann auch das Rechtssystem ausgerichtet sein.
Würden wir uns endlich zu einem solchen Bekenntnis durchringen, könnten dann auch die weiteren Rahmenbedingungen an die Hand genommen werden, die nötig sind, um dieses Familienmodell zu unterstützen. Beispielsweise im Bereich der finanzierbaren Kinderbetreuung.
Und Paare, die trotz allem an dem alten Familienmodell festhalten wollen? Die können das selbstverständlich weiterhin tun. Aber es hat dann eben einen Preis.
Titelbild: Parlamentsdienste, 3003 Bern, Pascal Morat. www.parlament.ch
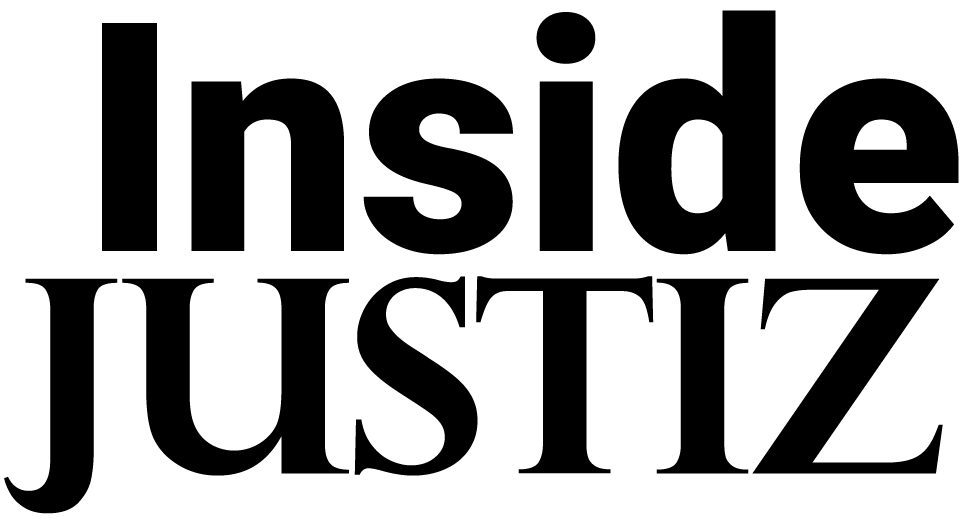
Das Steuerbeispiel stimmt natürlich heute schon nicht, Doppelverdiener können in allen Kantonen einen zusätzlichen Abzug auch bei bei der Bundessteuer machen, wer also individual 100‘&80‘ besteuert besteuert eben nicht 180 zusammen.
Hinzu kommt das es relativ wenig Kinderlose Ehepaare gibt diese werden ja gleich nochmals begünstigt