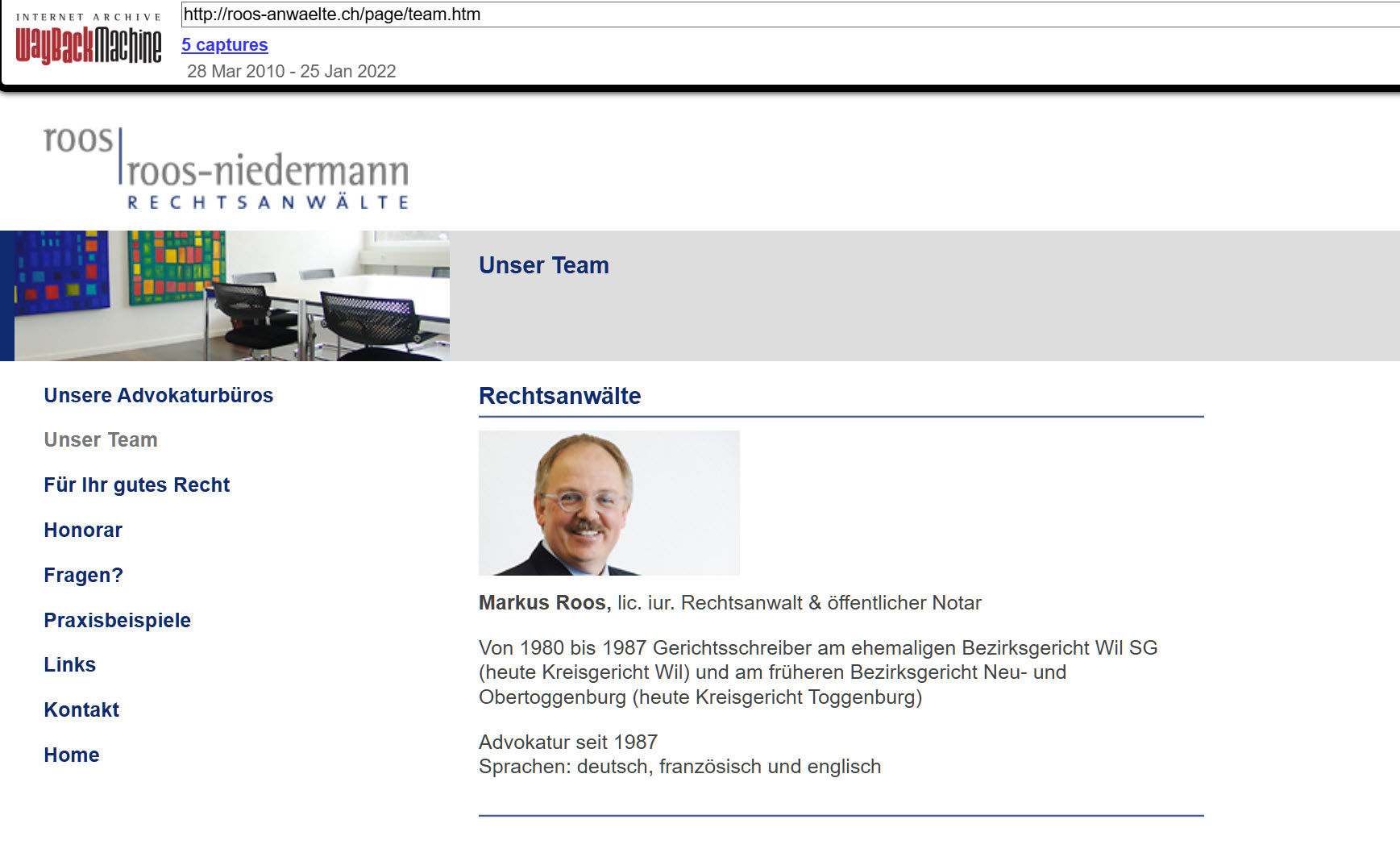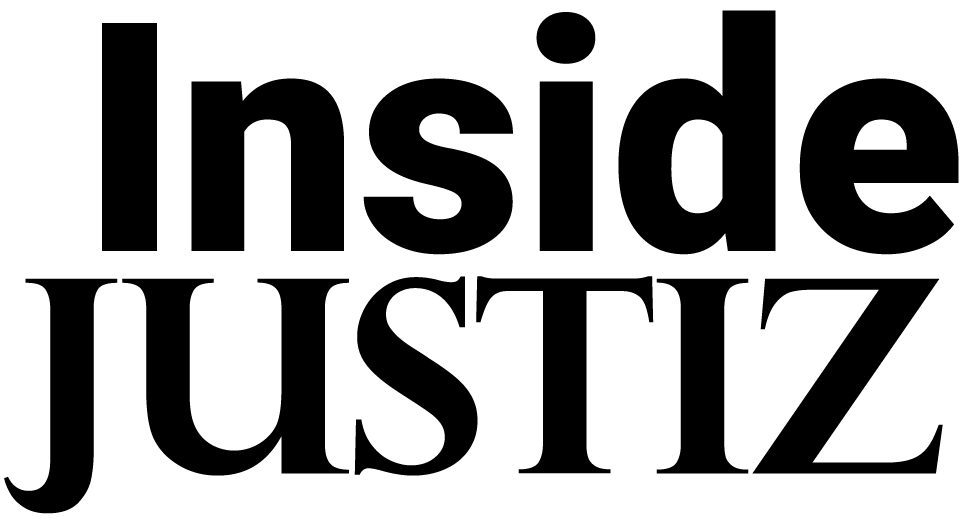Seit Jahren sorgt ein Fall im Toggenburg für Gesprächsstoff – in Dorfbeizen, in juristischen Kreisen und mittlerweile auch in der Politik. Im Zentrum steht der bekannte Anwalt Markus Roos aus Lichtensteig. Ihm wirft die St. Galler Staatsanwaltschaft vor, über Jahre hinweg Gelder in Millionenhöhe veruntreut zu haben – aus Nachlässen, bei denen er als Willensvollstrecker eingesetzt war, und aus Firmen, in denen er als Verwaltungsrat oder Geschäftsführer agierte.
Die Ermittlungen zeichnen ein erschütterndes Bild: Insgesamt geht es um rund 2,5 Millionen Franken. Die Anklage der Staatsanwaltschaft listet detailliert auf, wie Gelder verschoben, bar abgehoben oder auf private Konten überwiesen wurden – teils auch auf das gemeinsame Konto von Markus Roos und seiner Ehefrau, der ehemaligen St. Galler CVP-Regierungsrätin Rita Roos-Niedermann, die weiterhin die Kanzlei in Lichtensteig führt. Bis heute gilt die Unschuldsvermutung. Ein rechtskräftiges Urteil liegt nicht vor. Die SonntagsZeitung und das St. Galler Tagblatt haben in den vergangenen Tagen den Fall beleuchtet, den Namen des mutmasslichen Täters aber nicht genannt.
Ein Anwalt mit tadellosem Ruf
Bis zum Auffliegen der Affäre galt Roos als Musterjurist. „Geradlinig“ beschrieben ihn Zeitungen, als bodenständigen Mann mit starkem ehrenamtlichem Engagement im Toggenburg. Viele vertrauten ihm blind.
Auf diese Vertrauenswürdigkeit setzten zahlreiche Klienten: Sie setzten ihn in ihren Testamenten als Willensvollstrecker ein – in der Hoffnung, dass ihre Nachlässe professionell und korrekt abgewickelt würden. Dieses Vertrauen wurde, wie die Ermittlungen zeigen, offenbar schwer missbraucht.
Erste Ermittlungen, erste Geständnisse
Bereits 2019 gab es Hinweise, dass in mindestens einem Nachlass Unregelmässigkeiten bestanden. Ein Besprechungsprotokoll aus diesem Jahr belegt, dass Roos gegenüber einem Geschäftspartner einräumte, Gelder in grossem Stil für die Finanzierung seiner Kanzlei verwendet zu haben.
Im Mai 2022 folgte eine Schuldanerkennung, in der Roos einräumte, als Geschäftsführer einer betroffenen GmbH Straftaten wie Veruntreuung, Betrug, ungetreue Geschäftsbesorgung und Bilanzfälschung begangen zu haben – mit einem Schaden von über 1,1 Millionen Franken. Trotz dieser Eingeständnisse setzte er seine Tätigkeit fort – ein Fakt, der später auch das St. Galler Verwaltungsgericht beschäftigte.
Das dauerhafte Berufsverbot
Im August 2024 bestätigte das St. Galler Verwaltungsgericht in einem Entscheid ein dauerhaftes Berufsverbot für Markus Roos. Dieser Entscheid wird auf der kantonalen Publikationsplattform unter der Nummer 13015 geführt (Aktenzeichen B 2024/2 und B 2024/122). Er behandelt das dauerhafte Berufsverbot gegen einen Rechtsanwalt/Notar. Die Richter stellten dabei eine „erdrückende Beweislage“ fest und schrieb, dass Roos wiederholt „offensichtlich unangemessen hohe Vorschüsse“ auf Mandatsgelder verbucht habe. Kernaussagen des Urteils:
-
Bestätigung des dauerhaften Berufsverbots, das zuvor von der Anwaltskammer verhängt wurde.
-
Feststellung einer „erdrückenden Beweislage“, gestützt auf Besprechungsprotokolle (2019), eine Schuldanerkennung (2022) und Vergleichsvereinbarungen (2013).
-
Deutliche Kritik an der mehrfachen Verbuchung „unangemessen hoher Vorschüsse“ auf Mandatsgelder.
Gleichzeitig machten sie eine rechtliche Lücke sichtbar: Das Berufsverbot gilt nur für Tätigkeiten im sogenannten Anwaltsmonopol – also dort, wo das Gesetz den Auftritt eines Anwalts zwingend vorschreibt. Als „Rechtsberater“ darf Roos weiter tätig sein.
Diese Lücke sorgte für Empörung, nicht nur bei Geschädigten, sondern auch in der Politik. Der Mitte-Kantonsrat und Rechtsanwalt Adrian Gmuer, der mehrere Geschädigte vertritt, bezeichnete den Zustand als „Täuschung des Publikums“. Inzwischen liegt eine Motion im St. Galler Kantonsrat vor, die eine Gesetzesänderung fordert: Wer ein Berufsverbot hat, soll den Titel „Rechtsanwalt“ oder „Notar“ nicht mehr führen dürfen.
Schicksale hinter Zahlen
Die anonymisierten Akten beschreiben nüchtern Summen und Transaktionen. Hinter diesen Zahlen stehen Menschen. Einer von ihnen ist ein in Kanada lebender Erbe, der seiner Patentante besonders nahestand. Sie setzte ihn als Alleinerben für ihr Erspartes von über 100’000 Franken ein. Direkt nach ihrem Tod liess Roos gemäss Anklage 15’000 Franken in bar von ihrem Konto abheben – gegen Vorlage einer nicht unterzeichneten Eigenrechnung. Es folgten weitere Zahlungen: 10’000 Franken auf das Kanzleikonto, 10’800 Franken in bar und schliesslich 67’000 Franken auf das Ehekonto.
Der Erbe erfuhr jahrelang nichts. Auf Nachfrage wurde er hingehalten, getröstet – bis nichts mehr da war. „Wie kann man einen verstorbenen Menschen so hintergehen?“, sagt er heute.
Hilfsorganisationen als Opfer
Auch internationale Hilfsorganisationen gehören zu den Geschädigten. Nach dem Tod einer St. Gallerin, die einen grossen Teil ihres Vermögens für wohltätige Zwecke spenden wollte, soll Roos rund 234’000 Franken veruntreut haben. Unter den betroffenen Organisationen: Médecins Sans Frontières, Unicef und kleinere kirchliche Werke.
Eine Präsidentin eines betroffenen Hilfswerks beschreibt den Fall als „einzigartig in seiner Dimension“ und wirft auch den involvierten Banken Versagen vor.
Rolle der SGKB
Besonders im Fokus steht auch die St. Galler Kantonalbank (SGKB). In mehreren Fällen liess sie hohe Bargeldauszahlungen oder Überweisungen auf Kanzlei- und Ehekonto zu, ohne zu intervenieren. In einem anderen Erbfall stoppte die Bank zwar verdächtige Überweisungen – in anderen griff sie jedoch nicht ein.
Die Anwälte der Geschädigten sprechen von einer „groben Verletzung der Sorgfaltspflichten“ und haben im Februar 2025 Anzeige gegen einen Kundenberater der Bank wegen Gehilfenschaft zur Veruntreuung erstattet.
Konsequenzen
Der Fall Roos ist längst mehr als ein Einzelfall. Er zeigt strukturelle Probleme:
- Die fehlende Transparenz bei Disziplinarmassnahmen gegen Anwälte, nachdem das Bundesgericht 2024 entschieden hatte, dass Berufsverbote nicht mehr im Amtsblatt publiziert werden dürfen.
- Gesetzeslücken, die es gesperrten Anwälten erlauben, weiterhin als „Rechtsberater“ aufzutreten.
- Unklare Verantwortlichkeiten bei Banken, die trotz verdächtiger Transaktionen nicht reagierten.
Der St. Galler Kantonsrat arbeitet inzwischen an einer Anpassung des Anwaltsgesetzes. Ziel ist es, Klarheit zu schaffen und das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherzustellen.
Der ausstehende Strafprozess
Die Staatsanwaltschaft fordert für Markus Roos eine Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 9 Monaten. Ein erster Versuch, das Verfahren abzukürzen und eine teilbedingte Strafe von drei Jahren zu erwirken, scheiterte 2023 am Widerstand der Geschädigten.
Ein Hauptprozess war für 2024 angesetzt, wurde jedoch wegen angeblicher Verhandlungsunfähigkeit verschoben. Ein neuer Termin steht bis heute nicht fest.
Unschuldsvermutung und öffentliche Verantwortung
Markus Roos lässt sich über seinen Anwalt ausrichten, er nehme „keine Stellung zu den laufenden Verfahren“. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.
Trotzdem ist das öffentliche Interesse an diesem Fall unbestritten: Es geht um hohe Summen, um das Vertrauen in die Rechtsbranche und um die Frage, wie Betroffene besser geschützt werden können.
Reaktionen im Toggenburg
Im Toggenburg sorgt der Fall weiterhin für Gesprächsstoff. In Lichtensteig, wo Roos jahrzehntelang eine gut frequentierte Kanzlei führte, sprechen viele nur hinter vorgehaltener Hand. Für manche ist er „immer noch der hilfsbereite Anwalt von nebenan“, für andere ein Symbol für „das Versagen der Behörden“.
Ein ehemaliger Mandant sagt: „Ich habe ihm vertraut, wie man einem Freund vertraut. Dass er das ausgenutzt haben soll, kann ich immer noch nicht fassen.“
Auch in politischen Kreisen rumort es. Kritiker werfen den kantonalen Aufsichtsbehörden vor, zu spät reagiert zu haben. Der Präsident der kantonalen Anwaltsaufsicht verteidigt sich: Man habe im gesetzlichen Rahmen gehandelt, sobald konkrete Hinweise vorlagen. Rückblickend räumt er aber ein, „dass die Kontrollmechanismen zu schwach waren“.
Das rechtliche Minenfeld
Für die Betroffenen ist der Weg zur Gerechtigkeit kompliziert:
- Strafverfahren: Viele Geschädigte warten seit Jahren auf einen Prozess. Die wiederholten Verschiebungen – zuletzt wegen angeblicher gesundheitlicher Probleme des Angeklagten – haben Frustration ausgelöst.
- Zivilverfahren: Wer Schadensersatz einklagen will, muss hohe Kostenvorschüsse leisten. Für kleinere Erben oder Organisationen ist das kaum zu stemmen.
- Bankenhaftung: Ob und in welchem Umfang die St. Galler Kantonalbank für ihr Verhalten haftbar gemacht werden kann, ist juristisch umstritten.
- Juristen weisen darauf hin, dass die rechtliche Aufarbeitung noch Jahre dauern könnte. „Dieser Fall zeigt, wie träge unser System ist, wenn es um komplexe Wirtschaftskriminalität geht“, sagt ein Strafrechtsprofessor der Universität Zürich.
Politische Aufarbeitung
Eine Motion im St. Galler Kantonsrat verlangt deshalb klare Kennzeichnungspflichten für Anwälte mit Berufsverbot, bessere Aufsichtsinstrumente für kantonale Anwaltskammern und gesetzliche Klarheit, damit „Rechtsberatung“ ohne Zulassung nicht mehr als Schlupfloch genutzt werden kann.
Der Druck auf die Politik steigt. Ein Mitglied der Justizkommission formuliert es so: „Wir dürfen nicht länger zusehen, wie Personen, die das Vertrauen der Öffentlichkeit missbraucht haben, weiterhin ungehindert auftreten können. Das untergräbt das Vertrauen in die Justiz.“
Der Fall Roos legt systemische Schwachstellen offen:
- Lückenhafte Kontrolle: Disziplinarentscheide sind schwer zugänglich, die Aufsicht oft zahnlos.
- Mangelnde Transparenz: Betroffene erfahren häufig erst spät von laufenden Verfahren.
- Träge Justiz: Komplexe Verfahren ziehen sich über Jahre, was die Aufarbeitung erschwert.
Für Geschädigte bedeutet das nicht nur finanzielle, sondern auch emotionale Belastungen. Viele fühlen sich von den Behörden im Stich gelassen. „Es ist, als würde niemand Verantwortung übernehmen“, sagt ein Betroffener.
Was als Nächstes zu erwarten ist
Der Hauptprozess gegen Markus Roos vor dem Kreisgericht See-Gaster wird voraussichtlich im kommenden Jahr starten – ein konkretes Datum steht noch nicht fest. Die Staatsanwaltschaft fordert 5 Jahre und 9 Monate Freiheitsstrafe, eine teilweise unbedingt zu verbüssende Haft. Unklar ist, ob es zu einem Geständnis (das ja im abgekürzten Verfahren schon vorlag) oder zu einem langwierigen Beweisverfahren kommen wird. Klar ist aber schon jetzt: Der Fall wird auch in den nächsten Jahren für Schlagzeilen sorgen.
Titelbild: Combo Lichtensteig, Rita Roos und Hund, Aktuar Markus Roos als Aktuar des „Chormanne Mammern“
BGE 150 II 308 – das Urteil, das Kollegen schützt
Mit dem Urteil BGE 150 II 308 (2C_164/2023, 25. März 2024) entschied das Bundesgericht, dass Disziplinarmassnahmen wie ein Berufsverbot nicht im kantonalen Amtsblatt publiziert werden dürfen. Die Veröffentlichung sei eine «zusätzliche Sanktion» und damit nicht mit dem Bundesgesetz über den Anwaltsberuf (BGFA, Art. 17) vereinbar. Dieses Urteil hat weitreichende Konsequenzen. So bleiben Vertrauensberufe im Dunkeln. Anwälte oder Notare, die massiv gegen Berufsregeln verstossen oder sogar Straftaten begangen haben, erscheinen nicht mehr in offiziellen Publikationen. Dann verlieren Medien und die Öffentlichkeit Kontrollrechte. Ohne Zugang zu amtlich bestätigten Informationen können Missstände kaum transparent aufgearbeitet werden. Und dies führt dazu, dass Opfer zusätzlich geschädigt werden. Denn diese Geschädigten erfahren oft zu spät oder gar nicht, dass gegen einen Anwalt einschneidende Massnahmen verhängt wurden.
Medienrechtler und Aufsichtsorgane kritisierten das Urteil als „Täterschutz durch Rechtsformalismus“. Prof. Dr. Franz Zeller, Experte für Medien- und Öffentlichkeitsrecht, schreibt in Medialex: „Dieses Urteil ist ein Schlag gegen die Transparenz. Statt die Aufsicht über Berufsgeheimnisträger zu stärken, schützt das Bundesgericht diejenigen, die ihre Stellung missbrauchen. In sensiblen Bereichen wie der Advokatur ist das brandgefährlich, weil es Vertrauen in den Rechtsstaat untergräbt.“ Auch Vertreter von Anwaltsaufsichtsbehörden warnen, dass durch die fehlende Publikation eine Scheinsicherheit entstehe: Mandanten würden Anwälte weiterhin beauftragen, die längst gesperrt sind, weil sie schlicht nichts von den Sanktionen wissen. Im Fall Markus Roos zeigt sich die fatale Wirkung des Urteils besonders deutlich:
- Sein dauerhaftes Berufsverbot darf nicht namentlich im Amtsblatt erscheinen.
- Medien, die sich streng am Bundesgerichtsentscheid orientieren, nennen den Namen nicht – selbst bei belegten Vorwürfen und einer erdrückenden Beweislage.
- So entsteht ein Schutzschirm für Personen, die das Vertrauen in die Justiz ohnehin erschüttert haben.
Für inside-justiz ist dieses Urteil ein Fehlentscheid mit Signalwirkung: Es schwächt die Medien als Kontrollinstanz, es gefährdet die Transparenz in einem für den Rechtsstaat zentralen Bereich und es stärkt jene, die ihre Position missbrauchen. Rechtsstaatlichkeit lebt von Öffentlichkeit – wer diese Öffentlichkeit künstlich einschränkt, beschädigt das Vertrauen in Institutionen nachhaltig.
Markus Roos – Vernetzt und diskret
Markus Roos, Jahrgang 1951, stammt aus Lichtensteig (Kanton St. Gallen) und Romoos (Kanton Obwalden) und lebt heute in Mammern (Thurgau). Nach dem Studium der Rechtswissenschaften erhielt er 1987 das Anwaltspatent und wurde 1988 ins St. Galler Anwaltsregister eingetragen. Gemeinsam mit seiner Frau, der späteren St. Galler Regierungsrätin Rita Roos-Niedermann, eröffnete er die Kanzlei Roos | Roos-Niedermann an der Postgasse in Lichtensteig. Die Kanzlei war als klassische Landpraxis breit aufgestellt – von Zivil- und Erbrecht über Notariat bis hin zu Mandaten als Willensvollstrecker und Verwaltungsrat in verschiedenen Gesellschaften.
Roos wurde nicht nur als Anwalt, sondern auch als öffentlicher Notar bekannt. In den 2000er- und 2010er-Jahren vertrat er immer wieder Mandanten in öffentlich beachteten Fällen. Besonders sichtbar war er als juristischer Vertreter der Ortsgemeinde Benken in jahrelangen Auseinandersetzungen um den sogenannten Klettenseehof. Diese Verfahren, die über zwei Jahrzehnte dauerten, führten bis vor Bundesgericht und machten ihn in der Region zu einer bekannten Figur – auch wegen seines konfrontativen Stils gegenüber Medien und politischen Gegnern.
Über die Region hinaus war Roos ab 2009 im Umfeld des Schweizer Skispringens präsent. Er übernahm als Präsident und später Geschäftsführer die Leitung der Schanzen Einsiedeln GmbH, die den national bedeutendsten Stützpunkt des Skispringens betreibt. Zusammen mit Athleten wie Simon Ammann und Andreas Küttel engagierte er sich für die Stabilisierung und Weiterentwicklung der Anlage.
Öffentliche Auftritte oder Fachpublikationen sind von Roos kaum dokumentiert; er galt als diskreter, aber gut vernetzter Jurist, der seine Mandanten auch in konfliktbeladenen Situationen vertrat.
Markus Roos –
ein Fall von öffentlichem Interesse
Warum wir den Klarnamen nennen
Wir sind der Ansicht, dass in diesem aussergewöhnlichen Fall eine identifizierende Berichterstattung gerechtfertigt ist. Mehrere Gründe sprechen dafür, den Anwalt mit vollem Namen zu nennen, obwohl Medien im Normalfall zurückhaltend mit Klarnamen umgehen. Im vorliegenden Fall überwiegt das öffentliche Interesse an der Transparenz deutlich gegenüber dem Persönlichkeitsschutz. Die Argumente dafür sind:
Grosser Schaden und viele Betroffene
Der Fall betrifft Millionensummen und eine Vielzahl von Geschädigten, darunter sogar internationale Organisationen. Wenn derartige Summen veruntreut oder missbraucht worden sein sollen, hat die Öffentlichkeit ein Anrecht darauf zu erfahren, wer dafür verantwortlich gemacht wird. Die Tragweite des Falls – sowohl finanziell als auch in der Anzahl der Betroffenen – begründet ein erhebliches öffentliches Interesse an voller Transparenz.
Amtliche Dokumente liegen vor
Offizielle Entscheide und eine Anklageschrift dokumentieren die Vorwürfe detailliert. Es handelt sich also nicht um blosse Gerüchte oder unbestätigte Behauptungen, sondern um durch Behörden untermauerte Anschuldigungen. Wenn eine Staatsanwaltschaft Anklage erhebt und Gerichte sich bereits mit dem Fall befasst haben, ist die Namensnennung vertretbar. Die Vorwürfe sind schwarz auf weiss in gerichtlichen Akten festgehalten.
Transparenz über systemische Mängel
Es besteht ein legitimes öffentliches Interesse, systemische Schwächen im Aufsichts- und Justizsystem offenzulegen. Gerade weil der beschuldigte Anwalt mutmasslich Lücken oder Versäumnisse in der Aufsicht ausgenutzt hat, ist es wichtig, Ross und Reiter zu nennen. Nur so kann die Öffentlichkeit nachvollziehen, wie es zu solchen mutmasslichen Missständen kommen konnte und wer in verantwortlicher Position stand. Die Namensnennung trägt hier zur Aufarbeitung und möglichen Prävention künftiger Fälle bei, indem sie Verantwortlichkeiten klar benennt.
Verantwortung in wichtiger Position
Bei der betroffenen Person handelt es sich um einen Rechtsanwalt, also jemanden in einem besonderen Vertrauensberuf. Anwälte, insbesondere wenn sie Mandate für Organisationen führen oder Ämter (etwa Stiftungsrats- oder VR-Mandate) innehaben, tragen eine erhöhte Verantwortung. Wenn der Vorwurf lautet, ein Anwalt habe seine Position missbraucht, besteht ein erheblicher Öffentlichkeitswert. Der Schweizer Presserat hat in früheren Entscheiden festgehalten, dass bei Personen in leitender Stellung in einem gesellschaftlich bedeutenden Bereich eine Namensnennung grundsätzlich gerechtfertigt sein kann, wenn das Fehlverhalten in engem Zusammenhang mit dieser Funktion steht. Hier ist genau das der Fall – der Anwalt soll im Kontext seiner beruflichen Rolle Schaden angerichtet haben.
Zusammengefasst liegen Ausnahmekriterien vor, die gemäss den Richtlinien eine identifizierende Berichterstattung erlauben. Angesichts des überwiegenden öffentlichen Interesses halten wir die Klarnamennennung in diesem Fall für journalistisch vertretbar.
Bis zum rechtskräftigen Urteil ist Markus Roos als unschuldig zu betrachten.
Warum grosse Medienhäuser bei Namensnennungen immer öfter zögern
Wenn inside-justiz in diesem Fall deutlich Ross und Reiter nennt, steht das in Kontrast zur immer grösser werdenden Zurückhaltung etablierter Verlagshäuser bei der Namensnennung von Beschuldigten. Was früher in der Schweizer Presse beinahe selbstverständlich war – nämlich dass bei schweren Vorwürfen oder Anklagen auch die Namen der Täter oder mutmasslichen Täter genannt wurden – ist heute zur Ausnahme geworden. Viele grosse Medien verzichten zunehmend darauf, Verdächtige oder Angeklagte mit Klarnamen zu nennen, aus Angst vor juristischen Auseinandersetzungen und hohen Kosten.
Die Realität ist, dass investigative Journalisten und Verlage vermehrt mit gerichtlichen Klagen oder Drohungen überzogen werden. Eine aktuelle Studie zeigt, dass während der Corona-Pandemie 42 % der Schweizer Journalisten mit rechtlichen Schritten konfrontiert waren – ein Indiz dafür, wie stark der Druck durch Klagedrohungen auf Medienschaffende zugenommen hat. In diesem Klima scheuen viele Redaktionen das Risiko, Personen beim Namen zu nennen, solange keine rechtskräftige Verurteilung vorliegt, um nicht selbst ins Visier von Anwälten zu geraten.
Hinzu kommt der finanzielle Druck in der Medienbranche. Grosse Verlagshäuser wie CH Media oder die TX Group (Tamedia) stehen wirtschaftlich unter Anspannung. Ein langwieriger Gerichtsprozess wegen eines Enthüllungsartikels kann schnell hunderttausende Franken verschlingen – Summen, die sich klamme Medienhäuser kaum leisten können. Gleichzeitig gab es in den letzten Jahren mehrere Gerichtsentscheide, die den Medien zusetzen. Prominent ist etwa der Fall Spiess-Hegglin: Hier urteilte ein Gericht, dass ein Verlag (Ringier/Blick) den mit persönlichkeitsverletzenden Artikeln erzielten Gewinn an die Betroffene herausgeben muss. Die Ringier-CEO Ladina Heimgartner bezeichnete dieses Urteil als „fatalen Schlag für den freien Journalismus“. Und der Verlegerverband Schweizer Medien warnte, der Entscheid sei „brandgefährlich für die Medienfreiheit“, weil er es künftig erleichtere, Verlage mit der Androhung von Klagen einzuschüchtern und von Recherchen abzuhalten. Solche Entwicklungen verbreiten in den Chefetagen der Medienhäuser spürbar Unsicherheit. Man fürchtet Präzedenzfälle, in denen Medien für investigativen Mut hart bestraft werden – sei es finanziell oder reputationsmässig. Diese Furcht führt dazu, dass Verlage lieber zurückrudern, statt ihre Journalisten zu unterstützen.
Ein konkretes Beispiel für diese Zurückhaltung erlebten wir selbst bei unserer Recherche: Ursprünglich war geplant, unseren Artikel über den bekannten Zürcher Anwalt David Gibor gemeinsam mit einer grossen Sonntagszeitung zu veröffentlichen. Doch als der beschuldigte Anwalt zur Unterredung mit dem Verlag die bekannte Medienanwältin Rena Zulauf mitbrachte, schwand dort schlagartig der Mut.
Die erfahrene Anwältin Zulauf hatte besagtem Verlag (TX Group) in der Vergangenheit – etwa im Zuge des Spiess-Hegglin-Verfahrens – empfindliche juristische Niederlagen zugefügt, was bis heute anscheinend nachwirkt. In jenem Moment entschieden sich wohl der Journalist und die Verlagsjuristen, lieber auf Distanz zu gehen, statt sich auf ein mögliches Rechtsabenteuer einzulassen. Was aber, trotz unseres publizierten Artikels, nie passierte.
Ähnliches Verhalten hört man auch aus anderen Redaktionen: Bei CH Media zum Beispiel (etwa dem St. Galler Tagblatt) soll man eher bereit sein, einen heiklen Artikel vorsorglich vom Netz zu nehmen, als sich auf einen langwierigen juristischen Kampf einzulassen. Intern berichten aktuelle und ehemalige Journalisten, dass die Führungsetagen nur selten voll hinter investigativen Recherchen stehen, sobald ein Anwalt mit scharfem Geschütz droht. Selbst berechtigte und sauber recherchierte Enthüllungen werden dann unter Druck zurückgehalten oder verwässert.
Die Folgen dieser Entwicklung sind dramatisch für die vierte Gewalt. Wenn Verlage aus Sorge vor Klagen den Rückzug antreten, leidet am Ende die Öffentlichkeit. Fälle wie dieser – die ans Licht gehören – drohen unter den Teppich gekehrt zu werden, sobald ein aggressiver Anwalt auftritt. Was wir beobachten, ist leider ein Trauerspiel ohne Happy End: Wirtschaftliche Zwänge, juristische Drohkulissen und vergangene Gerichtsurteile haben einen Klimawechsel bewirkt. Viele Medienhäuser haben ihren einstigen Kampfgeist eingebüsst. Journalistische Prinzipien, wie das öffentliche Interesse über private Befindlichkeiten zu stellen, treten immer häufiger hinter juristische Vorsicht zurück.
Inside-justiz will sich dieser Tendenz bewusst entgegenstellen. Wir sehen es als unsere Aufgabe, Mut zur Transparenz zu zeigen – gerade weil andere zunehmend zögern. Die Namensnennung in unserem Artikel steht exemplarisch dafür, dass wir uns vom Druck möglicher Rechtsstreitigkeiten nicht einschüchtern lassen. Nur so können Missstände ans Licht kommen. Unser Appell lautet: Medien sollten wieder vermehrt ihrer Watchdog-Rolle gerecht werden und sich nicht vom „chilling effect“ juristischer Drohungen lähmen lassen. Im Interesse der Allgemeinheit dürfen wir uns Klarheit und Aufklärung nicht durch die Aussicht auf Prozesse nehmen lassen.
Roger Huber