Der TAGESANZEIGER lässt sich für eine Kampagne gegen einen Mann einspannen, der 2014 im Ketaminrausch einen ebenfalls stark unter der Droge stehenden Freund getötet und schon davor seine ehemalige Verlobte vergewaltigt hatte. Warum das problematisch ist und wie die Schweizer und englische Medienlandschaft zur Hetzjagd bläst.
Es ist unbestritten, dass die Opfer von Straftaten je nach Persönlichkeit und Delikt auch noch Jahre nach der Tat unter dem leiden, was ihnen widerfahren ist. Zeit heilt eben doch nicht alle Wunden – oder manchmal nur sehr, sehr langsam. Das gilt wohl umso mehr bei den Hinterbliebenen von Tötungsdelikten. Sie müssen damit fertig werden, dass sie ihre Liebsten für immer verloren haben, während die Täter – und seltener Täterinnen – die Chance erhalten, nach ihrer Strafe wieder in ein geordnetes Leben zurückzukehren. Das ist für Angehörige manchmal nur schwer zu ertragen – und das ist nachvollziehbar.
Der TAGES-ANZEIGER als Kampagnen-Organ
Aktuell macht die Geschichte um einen Mann aus besten Zürcher Verhältnissen die Runde. Der TAGES-ANZEIGER berichtete am letzten Freitag auf einer gesamten Zeitungsseite, dass der früher als «Galeristensohn» apostrophierte junge Mann, der am 30. Dezember 2014 im Ketamin- und Kokainrausch einen guten Freund getötet hatte, nicht nur wieder auf freiem Fuss sei.
Sondern unter falschem Namen auch noch auf einer Dating-Plattform aktiv. Die Journalistin Michèle Binswanger zitiert ausführlich die Mutter des damaligen Opfers, Katja Faber, die sich darüber empört, dass der Mann offenbar wieder Kontakt zum anderen Geschlecht suche. Und das, ohne dass die ahnungslosen Frauen auf der Dating-App über die Vergangenheit des Mannes informiert und gewarnt würden.
«Ein verurteilter Vergewaltiger agiert unter falschem Namen auf Datingplattformen. Wer verantwortet das – die App-Anbieter oder das Rechtssystem?» empört sich der TAGES-ANZEIGER im Untertitel. Und berichtet in der Folge von einer Frau, die mit dem Mann ein Date gehabt habe, «bei dem er unter dem Pseudonym Benjamin Schwarz offen mit seiner Haftzeit prahlte und ‘verbal aggressiv’ wurde, bevor er versuchte, sie in ein Hotel zu locken.»
Screenshot: Nicole Dill in einer Sendung von SRF.
Schon wieder ein Fall wie bei Nicole Dill?
Tatsächlich lässt der Artikel im «TAGI» auf den ersten Blick Erinnerungen aufkommen an einen anderen Fall, der eben erst wieder Schlagzeilen machte: Nicole Dill hatte im März 2025 in Strasbourg einen Sieg vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte errungen (INSIDE JUSTIZ berichtete).
Dills Geschichte: Sie hatte 2007 einen Mann kennengelernt – ohne Ahnung, dass es sich bei ihm um einen verurteilten und weiterhin gefährlichen Vergewaltiger handelte. Als sie sich von ihm trennen wollte, hatte der Mann sie beinahe umgebracht – nur durch eine glückliche Fügung konnte sie ihm grad’ noch entkommen. Der EGMR hielt nun fest, es habe gegen die Menschenrechte verstossen, dass die Frau von den Behörden nicht vor dem Mann gewarnt worden war.
Nur, und hier kommt es nun zum entscheidenden Unterschied: Im Fall von Nicole Dill existierte ein psychiatrisches Gutachten, das dem Mann weiterhin ein akut hohes Gefahrenpotential beschied. Und es wurden längst Massnahmen eingeführt, um eine Wiederholung der ,Causa Dill’ zu verhindern, darunter etwa den «risikoorientierten Sanktionenvollzug», der auch in Zürich angewandt wird. Die Luzerner Regierung hatte schon 2014 in der Antwort auf ein Postulat aus dem Grossen Rat über die Massnahmen berichtet.
Keine Belege für eine anhaltende Gefährdung
Für eine anhaltende Gefährdung durch den Täter aus dem tragischen Küsnachter Tötungsfall kann auch der TAGES-ANZEIGER keine konkreten Belege nennen. Aus dem Text erschliesst sich, dass die Zeitung sich einzig auf die Aussagen von Katja Faber abstützt, der Mutter des Opfers. Dass der verurteilte Mann auf Dating-Apps unterwegs sei, sei ihr, Faber, von Frauen zugetragen worden sein, die dort ebenfalls aktiv sind. Das einzige behauptete Indiz für den Vorwurf ist die Erzählung einer Frau, welche aus Angst vor ihm geflüchtet sein will, weil er «verbal aggressiv» geworden war und sie «in ein Hotel locken» wollte.
Der Text beinhaltet keinen Anhaltspunkt wie z.B. ein direktes Zitat, das darauf hinweisen würde, dass der TAGES-ANZEIGER mit dieser Frau selbst gesprochen hätte – die Information stammt deshalb wohl ebenfalls aus zweiter Hand und von Faber. Eine entsprechende Nachfrage von INSIDE JUSTIZ bei der Autorin verblieb ohne Antwort. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Quelle der Informationen findet nicht statt.
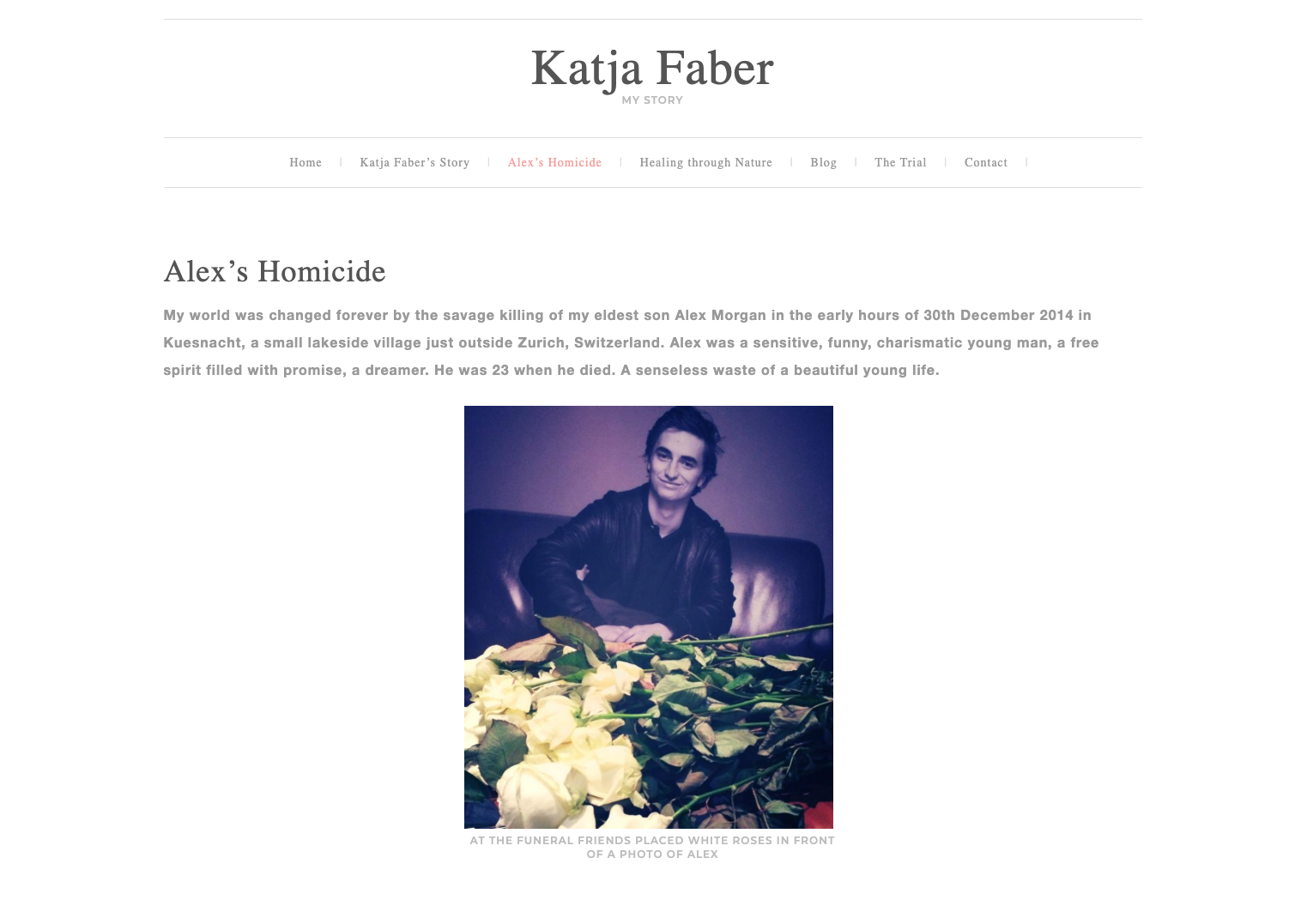
Screenshot: Homepage der Mutter des Opfers. Katja Faber verarbeitet den Verlust Ihres Sohnes offensiv in aller Öffentlichkeit. Aber wo liegt die Grenze zwischen Verarbeitung und Rachefeldzug?
Die Rolle der Mutter des Opfers
Diese Quelle, Katja Faber, ist gemäss englischen Zeitungen «Barrister and Journalist», also Prozessanwältin und Journalistin. Und damit vom Fach. Tatsächlich hat sie seit der Tat die Öffentlichkeit nie gescheut – Im Gegenteil. Im Internet verarbeitet sie den tragischen Tod ihres Sohnes auf einer eigenen dafür erstellten Webseite. Da sind Aussagen und Ankündigungen zu finden, die durchaus einen bedrohlichen Charakter aufweisen. Etwa, wenn sie über ihre Mission schreibt: «I am in for the long haul. However hard and exhausting the journey, I will not bow down until justice is served.» («Ich stelle mich auf einen langen Weg ein. Wie hart und anstrengend die Reise auch sein mag, ich werde nicht aufgeben, bis Gerechtigkeit herrscht.» Und ganz offensichtlich herrscht die aus ihrer Sicht (noch) nicht.
An anderer Stelle schreibt Faber: «By writing my own private journal and subsequently contributing to the book – Surviving My First Year of Child Loss – as well as becoming a contributor for Still Standing Magazine and other publications, I have found a way of helping others. In doing so, I also hope to heal myself.» («Indem ich mein eigenes Tagebuch schreibe und anschliessend zum Buch „Überleben meines ersten Kindesverlustjahres“ beitrage, sowie als Autorin für das Still Standing Magazine und andere Publikationen arbeite, habe ich einen Weg gefunden, anderen zu helfen. Dabei hoffe ich auch, mich selbst zu heilen.»).
Öffentlichkeitsarbeit meist in Englisch
Faber ist zwar in Stäfa bei Zürich aufgewachsen, wie in den Medien zu erfahren ist, in Interviews im SCHWEIZER FERNSEHEN und auf ihrer Homepage spricht und schreibt sie jedoch in englischer Sprache. Medienschaffende werden für Interviewanfragen an das englische Verlagshaus «Curtis Brown» mit Sitz in London verwiesen. Die englische Boulevardpresse dankt ihr ihre Offenheit mit regelmässigen Artikeln.
Für den Dokumentarfilm «Verbrechen im Wahn» des SCHWEIZER FERNSEHEN öffnete Faber schon im August 2023 das Fotoalbum der Familie und liess sich tränenreich interviewen. Im März 2024 folgte in der NZZ AM SONNTAG bereits das zweite ausführliches Portrait inklusive dazugehörigem Podcast. Eine erste grosse Geschichte von ihr war schon 2017 erschienen. Dazu existieren verschiedene weitere Podcasts mit ihr.
Die Schweizerische Mediendatenbank weist auf die Suchanfrage Katja Faber rund 60 Artikel aus. Die Frau scheint beseelt von der Mission, nicht nur ihren Sohn und die Tat unvergessen zu halten, sondern auch die Resozialisierung des Täters zu torpedieren. Oder wie es ein Kommunikationsexperte sagt: «Was sie macht, ist höchst professionelles Campaigning gegen den Täter.»

Vielleicht auch nicht grad schlau: Der Täter von Küsnacht trägt auch selbst dazu bei, mit provokativen Aktionen immer wieder Medienstoff zu liefern, wie auf diesem Instagram-Bild, das prompt beim Blick landete.
Medien bieten gerne eine Plattform
Und die Medien machen die Kampagne dankbar mit. Die TAGES-ANZEIGER-Geschichte wurde über die letzten Tage schweizweit aufgenommen. Die TRIBUNE DE GENEVE bringt den Binswanger-Artikel in französischer Übersetzung, andere springen auf das Thema an. Von 20MINUTEN.CH, NAU.CH, WATSON.CH und sämtliche Kopfblätter des TAGES-ANZEIGER. Das ungeschickte bis ungebührliche Verhalten des Täters macht es ihnen auch leicht, die Emotionen des Publikums in Wallung zu bringen.
Laut einem BLICK.CH -Artikel vom 12. Mai 2025 zeigte sich der Mann nämlich erst kürzlich auf einem Foto in seinem Instagram-Account mit Stinkefinger und dem Spruch («Catch me if you can»). Gemäss BLICK.CH soll er im April auf einer Reise in Südostasien gewesen sein. Gleichzeitig hat er die Schulden aus dem Strafprozess nicht abbezahlt und schuldet z.B. der Mutter des Opfers eine sechsstellige Summe – gemäss ihrer eigenen Darstellung. Hatte der Mann früher in der Person von Andreas Meili noch einen Medienanwalt zur Seite, kommt der Mann in der aktuellen Artikelwelle nicht zu Wort. Allerdings scheint auch nur der TAGES-ANZEIGER überhaupt versucht zu haben, eine Stellungnahme einzuholen.
 Wo endet die Kampagne und beginnt die Hetzjagd? Ausriss Tages-Anzeiger vom Freitag, 13. Juni 2024
Wo endet die Kampagne und beginnt die Hetzjagd? Ausriss Tages-Anzeiger vom Freitag, 13. Juni 2024
Ab wann gilt es als Hetzjagd?
Was auffällt: Mit der Genauigkeit in der Berichterstattung ist es nicht weit her. So schreibt schon der TAGES-ANZEIGER im Titel: «Mörder lockt auf Dating-App Frauen an». Das ist nicht nur in einer problematischen Art zugespitzt, sondern auch schlicht falsch. Der Mann ist kein Mörder.
Der Straftatbestand des Mordes ist eine qualifizierte Tötung, die sich durch eine besondere Skrupellosigkeit auszeichnet. Geregelt in Art. 112 StGB und mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe oder einer solchen nicht unter 10 Jahren bedroht. Das stand vorliegend nie zur Debatte. Die Tötung im Drogenrausch in Küsnacht wurde als vorsätzliche Tötung nach Art. 111 StGB gewertet, wo eine Mindeststrafe von 5 Jahren angedroht ist.
Der TAGES-ANZEIGER bezichtigt den Mann also eines Straftatbestandes, den er nicht begangen, für den er nie angeklagt und schon gar nicht verurteilt wurde.
Aber soviel juristische Genauigkeit war auch bei der NZZ AM SONNTAG schon nicht auszumachen. Die anderen Medien schreiben unqualifiziert und unreflektiert ab. Den falschen Begriff «Mörder» übernehmen praktisch alle Redaktionen. Auf 20MINUTEN.CH heisst es genau so falsch: «Verurteilter Mörder flirtet auf Dating Apps», in einer früheren Version sogar noch: «Wegen Mordes verurteilt: Jetzt trifft er Frauen über Bumble». Auch da: Beides falsch. Die gedruckte 20MINUTEN lässt die ausgebildete Anwältin Faber im Titel als Zitat sagen: «Er hat meinen Sohn ermordet – und datet, als wäre nichts gewesen.»
Geht es hier wirklich noch um Auf- und Verarbeitung, «um selbst zu heilen» – oder eher darum, mittels einer Rufmord-Kampagne Selbstjustiz zu betreiben, um den getöteten Sohn auf diese Weise zu rächen?
Eine Frage, die sich auf den Redaktionen niemand zu stellen scheint.
Von Schludrig bis erfunden
Viele Medien scheitern aber auch schon beim simplen Abschreiben. So heisst es im Originaltext des TAGES-ANZEIGER über Katja Faber: «Sie berichtet von zwei Frauen, die N.N. (Initialen von IJ geändert) auf Dating-Apps begegnet sind und ihr Screenshots geschickt haben: Einmal posiert er vor einem romantischen Teich, einmal mit Sonnenbrille in einem verspiegelten Hauseingang.»
Daraus wird dann bei WATSON.CH: «Katja Faber berichtet gegenüber dem «Tagesanzeiger» von zwei Frauen, die N.N. auf ein Date getroffen hatten, ohne zu wissen, um wen es sich dabei handelt. Die beiden Frauen hätten ihr Screenshots des Datingprofils geschickt. Einmal posiert B. V. vor einem romantischen Teich, einmal mit Sonnenbrille in einem verspiegelten Hauseingang.»
Dass «auf einer Dating-App begegnet» nicht dasselbe ist wie «auf ein Date getroffen» – geschenkt! Dass die Frauen nicht gewusst hätten, um wen es sich handelt? Wohl schlicht frei erfunden. Denn: Wie wären die Frauen auf die Idee gekommen, Faber die Screenshots zuzustellen, wenn sie den Mann nicht erkannt hätten?
Aber auch 20MINUTEN kann es in der gedruckten Ausgabe nicht besser. Dort wird aus der Original-Passage des TAGES-ANZEIGER die folgende Version: «Mehrere weibliche Nutzer hätten ihr Screenshots von der Datingtätigkeit des 40-Jährigen geschickt. Wie sie erzählten, hatte er jeweils bei Dates mit seiner Gefängnisvergangenheit geprahlt. Er sei dabei auch «verbal aggressiv» geworden und habe versucht, eine Frau in ein Hotel zu drängen.» Auch hier wird insinuiert, dass die Frauen, die Screenshots geschickt hätten, auch auf Dates mit dem Verurteilten gewesen wären und er mehrfach «verbal aggressiv» geworden sei. Was klar dem Sachverhalt widerspricht, wie er im TAGES-ANZEIGER geschildert wird.
Eine grosse Nummer auch in England
Ein Medienthema ist der Mann aber nicht nur in der Schweiz immer wieder. Auch die englischen Medien wie z.B. die DAILY MAIL haben die Geschichte aufgegriffen. Heute wie schon damals pflegen die englischen Medien einen völlig anderen Umgang mit den Namen der involvierten Personen: Sie veröffentlichen die Geschichte über den Mann, der seine Strafe verbüsst hat, mit Klarname und unverpixeltem Bild. Resozialisierung? Kein Begriff in England.
Zum Missfallen des TAGES-ANZEIGERS kennen die Schweiz – und eigentlich die ganzen westlichen Demokratien ausserhalb des angelsächsischen Raums – da andere Regeln.
Immerhin: Der TAGES-ANZEIGER hält sich an die hiesigen Regeln, schreibt über den Mann derweil mit dessen richtigen Initialen. Mit etwas Kombinatorik lässt sich über eine Google-Suche aber auf einfache Weise der Klarname des Mannes herausfinden – inklusive seinem LinkedIn-Profil mit Bild. Auf 20MINUTEN.CH, wird in der Regel beim kleinsten Verdacht, ein Thema könnte zu politisch unkorrekten Kommentaren führen, die Kommentarfunktion gar nicht aufgeschaltet. Wenn es gegen einen früheren Straftäter geht, ist jede Zurückhaltung abgelegt. Ein Leserbriefschreiber darf eine detaillierte Anleitung geben, wie man den Namen findet, ein anderer publiziert ihn gleich – bis auf die letzten vier Buchstaben. Weder Rechtsdienst noch Redaktion schreiten ein gegen die offensichtliche Persönlichkeitsrechtsverletzung. Der INSIDE-JUSTIZ-Redaktionskollege meint betreten: «Wetten, die Kommentarfunktion wäre nie aktiviert worden, wenn es sich bei dem Täter um einen eritreischen Flüchtling gehandelt hätte statt um einen Goldküstenjungen, der mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen, narzistisch veranlagt und Deutscher ist?»

Fröhliche Jagd nach dem Klarnamen des Täters: Leserkommentar auf 20minuten.ch – Und niemand in der Redaktion schaut hin.
Resozialisierung statt Stigmatisierung
Dabei ist das Ziel der Schweizer Strafjustiz die Resozialisierung – und eben keine lebenslängliche Ausgrenzung und Stigmatisierung, die es einem verurteilten Täter verunmöglicht, in der Gesellschaft wieder Fuss zu fassen und ein «prosoziales Leben» zu führen, wie es in der Expertensprache heisst. Täter, auch solche, die schwere Verbrechen begangen haben, sollen wieder ein geordnetes Leben aufnehmen können, wenn sie ihre Strafe verbüsst haben und die Bedingung erfüllen, dass sie keine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen. «Es ist ein System, das die Privatsphäre von Tätern höher gewichtet als die Sicherheit möglicher Opfer», findet Binswanger im TAGES-ANZEIGER.
Falsch, sagen Strafrechtsexperten. Aber die Sicherheit respektive Gefährlichkeit von Straftätern, die ihre Strafe verbüsst haben, beurteilen nicht Journalistinnen und auch nicht die Angehörigen von ehemaligen Opfern. Sondern Fachleute. Wenn ein Verurteilter auf Bewährung freigelassen wird, können die Behörden zudem Bewährungsauflagen verhängen.
Eine Anfrage von INSIDE JUSTIZ dazu bei den Zürchern Bewährungs- und Vollzugsdiensten blieb bislang unbeantwortet, eine Stellungnahme aber in Aussicht gestellt. INSIDE-JUSTIZ wird darüber berichten. Dafür gibt das zweite Berufungsurteil des Zürcher Obergerichts vom 31. Mai 2022 bereits einen guten und detaillierten Einblick in den bisherigen Verlauf. Ab Seite 97 wird dort ausführlich geschildert, wie der Vollzug in der Zeit bis 2022 beurteilt wurde.
Der Verurteilte befand sich zum Zeitpunkt dieses Urteils bereits nicht mehr in einem Gefängnis, sondern in einer «Massnahme», konkret hier in einer – anfangs –geschlossenen stationären Suchttherapie. Das Urteil zitiert aus dem aktuellen Vollzugsbericht, im Rahmen dieser Therapie hätten dem Täter aufgrund des Therapieerfolges immer wieder Hafterleichterungen gewährt werden können.
Die regelmässig durchgeführten Drogen- und Alkoholtests seien stets unauffällig geblieben und der Täter seit längerer Zeit «totalabstinent». Der Mann habe ein Fernstudium in Immobilienmanagement begonnen und könne als Gasthörer an der Universität Bern Vorlesungen im Fach Kunstgeschichte besuchen. Wörtlich: «Folglich sei das Delinquenzrisiko im Rahmen der zu prüfenden Vollzugsöffnungen als gering zu beurteilen.»
Das Pendel hat längst in die andere Richtung ausgeschlagen
Natürlich können sich Behörden bei einer solchen Einschätzung auch täuschen, was in früheren Jahren auch immer wieder geschah. Und nicht nur für grosse Schlagzeilen sorgte, sondern auch politische Implikationen hatte. Die Verwahrungsinitiative war eine der Reaktionen auf eine Strafjustiz, die zu früheren Zeiten in den Augen vieler Bürgerinnen und Bürger zu lax mit gefährlichen Tätern umgegangen war.
Der damalige teilweise wohl naive Glaube an das Gute im Menschen ist indes einer kritischeren Betrachtung gewichen. Im konkreten Fall hält der Vollzugsbericht denn auch fest, «dass beim Beschuldigten gemäss gutachterlicher Einschätzung bei Fortsetzung des Substanzkonsums eine hohe Rückfallgefahr für Gewaltdelikte bestehe». Weshalb «die Suchtmittelabstinenz des Beschuldigten regelmässig überprüft und bei einem Konsumrückfall umgehend interveniert» wird.
In der Strafrechtspflege verläuft die Debatte unterdessen nämlich gänzlich andersrum. Viele mit der Materie Befasste berichten INSIDE JUSTIZ, das Pendel im Vollzug habe auf die andere Seite ausgeschlagen. Sie beklagen heute vielmehr, dass der gesellschaftliche und mediale Druck und die Null-Risiko-Haltung dazu führen, dass z.B. einmal Verwahrte praktisch keine Chance haben, zeitlebens wieder in Freiheit zu kommen. So bleiben frühere Vergewaltiger auch noch verwahrt, wenn sie längst im Rentenalter sind und wohl schon rein körperlich kaum mehr eine Gefahr darstellen können. Aber kaum ein Psychiater oder Richter will sich dem Vorwurf aussetzen, eine Gefahr nicht gesehen zu haben und damit ein neues Opfer verantworten zu müssen.
Titelbild: Envato Elements
Die Urteile zum Fall
Vier der fünf Urteile, die in dem Tötungsdelikt an der Goldküste ergangen sind, sind öffentlich zugänglich. Nicht im Internet zu finden ist lediglich das erstinstanzliche Urteil des Bezirksgerichts Meilen. Hier in Kürze ein Überblick über die Urteile und die hauptsächlichsten Inhalte:
DG160012 des Bezirksgerichts Meilen vom 29. Juni 2017
Das erstinstanzliche Urteil des Bezirksgerichts Meilen ist als einziges nicht online einsehbar. Aufgrund der damaligen Medienberichterstattung und der späteren Urteile kann rekonstruiert werden, dass das Bezirksgericht zum Schluss kam, dass der Täter nur teilweise schuldfähig war. Es verurteilte ihn nach Art. 111 StGB für eine vorsätzliche Tötung. Die Vergewaltigung und die sexuellen Nötigungen gegen seine frühere Verlobte sahen die Bezirksrichter als erstellt an und verurteilten ihn auch dafür.
Insgesamt verfügte das Bezirksgericht eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren und sechs Monaten. Hinzu kamen mehrere Delikte im Strassenverkehrsrecht, für die der Täter eine Busse von CHF 2’000 kassierte. Die Strassenverkehrsdelikte wurden von keiner Seite weitergezogen, die diesbezügliche Verurteilung erwuchs damit schon nach dem erstinstanzlichen Urteil in Rechtskraft.
SB 170499-O vom 27. November 2019
Im ersten Berufungsverfahren am Zürcher Obergericht kamen die drei Richter Stefan Volken (GLP), Nicole Klausner (Grüne) und Claudia Keller (Mitte) zum Schluss, der Täter sei zum Tatzeitpunkt aufgrund einer durch die Drogen ausgelösten Psychose nicht schuldfähig gewesen. Sie stützten den Entscheid darauf, dass der Täter bei den beiden Gutachtern erzählt hatte, sein Freund sei ihm zum Tatzeitpunkt als grüner Alien mit roten Augen und langen Ohren erschienen, der ihm nach dem Leben getrachtet habe. Er habe deshalb sein eigenes Leben verteidigten müssen. Das Gericht verurteilt den Täter deshalb nach Art. 263 Abs. 2 StGB lediglich für das «Verüben einer Tat im Zustand selbstverschuldeter Unzurechnungsfähigkeit» zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren sowie zu einer stationären Massnahme zur Suchtbehandlung.
Sämtliche gerichtlichen Ausführungen zum Vorwurf der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung sind in dem Urteil zensiert und auch die Berichterstatter der Medien scharfen Zensurmassnahmen unterworfen. Erst durch das nachfolgende Bundesgerichtsurteil wurden der Öffentlichkeit die konkreten Tatvorwürfe im Detail bekannt. Bekannt wurde zu diesem Zeitpunkt lediglich, dass der Beschuldigte von den Anklagepunkten Vergewaltigung und sexuelle Nötigung freigesprochen wurde, weil das Gericht die Ausführung der Geschädigten – der ehemaligen Verlobten des Täters – keinen Glauben schenkten.
6B_257/2020, 6B_298/2020 vom 24. Juni 2021
Gegen das milde Urteil des Obergerichts führten die Staatsanwaltschaft und die ehemalige Verlobte Beschwerde am Bundesgericht. Die fünf Bundesrichter Laura Jacquemoud-Rossari (CVP), Christian Denys (Grüne), Giuseppe Muschietti (FDP), Beatrice van de Graaf (SVP) und Christoph Hurni (GLP) schulmeisterten die Zürcher Oberrichter richtiggehend, hoben das Obergerichts-Urteil vom 27. November 2019 in allen Punkten auf uns wiesen den Fall zur Neubeurteilung an das Zürcher Obergericht zurück.
Beim Vorwurf der vorsätzlichen Tötung argumentierten die Bundesrichter primär formalistisch: Die Psychose, als die Wahnvorstellung des grünen Alien, habe der Beschuldigte lediglich in den Explorationsgesprächen bei den Gutachtern ausgesagt und nicht in den Verhören. Nur die Verhören seien aber «justizkonform», deshalb dürfe das Gericht nicht auf die Aussagen beim Gutachter abstützen.
Die Freisprüche zu den Sexualstraftaten schlug das Bundesgericht den Zürcher Richtern regelrecht um die Ohren. Die Beweiswürdigung sei willkürlich, der Vorwurf, das Opfer sei nicht glaubwürdig, sei mit der vorgebrachten Argumentation unhaltbar. Dazu fügte das Bundesgericht seitenweise Literaturverweise ein, was verschiedene Juristen so deuten, dass das Bundesgericht den Zürcher Oberrichtern damit ans Herz legte, sich dringend kundig zu machen und ihnen damit zwischen den Zeilen völlige Inkompetenz vorwarf.
Damit musste nun das Zürcher Obergericht ein zweites Mal ran und tat dies in neuer Besetzung mit den Oberrichtern Beat Gut (FDP), Claudio Maira (Mitte) und Claire Brenn (parteilos). Der Spruchkörper musste erneut über die Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil des Bezirksgerichts Meilen urteilen, dieses Mal aber unter Berücksichtigung der Kritikpunkte, welche das Bundesgericht angebracht hatte.
Der neue Spruchkörper kam nun beim Tötungsdelikt zum Schluss, dass die Alien-Ausführungen nicht glaubwürdig seien. Das Gericht wog die früheren Aussagen des Beschuldigten ausführlich ab und kam schliesslich zum Schluss, seine Schuldfähigkeit sei durch die Drogen nur teilweise vermindert und nicht vollständig gewesen.
Die Sexualstraftaten, einerseits die anale Vergewaltigung der ehemaligen Verlobten im Hotelzimmer während eines Städtetrips in London wie auch die unmittelbar anschliessenden sexuellen Handlungen, die als sexuelle Nötigungen gewürdigt wurden, erachtete das Obergericht dieses Mal als erstellt.
Das Urteil lautete auf 12 Jahre Freiheitsstrafe, wobei der Täter sich zum Zeitpunkt dieses Urteils bereits in der Massnahme befand – also der stationären Drogentherapie. Das Gericht ordnete diese Massnahme noch einmal an, damit sie weitergeführt werden konnte.
7B_202/2022 und 7B_203/2022 vom
18. Oktober 2023
Auch gegen das zweite Berufungsurteil des Obergerichts wurde wieder Beschwerde geführt, dieses Mal vom Täter und der Staatsanwaltschaft. Letztere verlangte vor allem, dass das Strafmass auf 16 Jahre erhöht werde. Der Täter akzeptierte zwar die Verurteilung wegen der Tötung, wehrte sich aber gegen die Vorwürfe der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung und beantragte, diese Verurteilungen aufzuheben und ihn in diesen Anklagepunkten freizusprechen.
Das Bundesgericht wies dieses Mal beide Beschwerden ab und bestätigte den Entscheid des Zürcher Obergerichts, der damit in Rechtskraft erwuchs, als quasi «endgültig» wurde. Der Entscheid des Bundesgericht bildete damit den Abschluss des gesamten Rechtswegs. Mit diesem Urteil steht auch fest, dass der Täter nicht, wie medial immer wieder behauptet, zu zwölfeinhalb, sondern zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde.
Ein gefundenes Fressen für die SVP
Die Geschichte um die vorsätzliche Tötung hat unterdessen auch die Politik erreicht. Verschiedene SVP-Exponentinnen haben die TAGES-ANZEIGER-Kampagne aufgegriffen.

SVP-Nationalrätin Nina Fehr Düsel verlangt eine ID-Verifikation auf Dating-Plattformen. Dafür ist Fehr auch bereit, den Datenschutz zu opfern. Wie durchdacht ihr Vorschlag wohl ist? Gemäss 20minuten.ch stellt sie sich «eine ID-Verifikation bei der Anmeldung» vor oder «ein Scan ohne Speicherung der Daten». Wie das gehen soll, erläutert sie nicht – und die Zeitung fragt auch nicht nach.
Deshalb: Zum aktuellen Zeitpunkt existiert für Schweizerinnen und Schweizer keine E-ID. Eine solche soll nun zwar eingeführt werden, allerdings läuft die Referendumsfrist und ein Referendumskomitee ist dabei, Unterschriften zu sammeln. Bei letzten Versuch wurde eine Vorlage für eine I-ID vom Volk abgelehnt. Bleibt technisch die Möglichkeit, seine Identität mit einem Scan des Passes oder der ID und einer parallelen Überprüfung über die Video-App zu bestätigen. So, wie es Banken z.T. tun. Die Forderung von Düsel-Fehr, die Daten dürften dabei nicht gespeichert werden, erscheint dabei wenig durchdacht: Wie sollen die Betreiberfirmen der Apps beweisen können, dass sie eine Identität kontrolliert hätten, wenn sie die Daten nicht speichern dürfen? Das dürfte komplett illusorisch sein.
Und: Viele gerade der Handy-Apps wie Tinder, Bumble, etc. gehören US-amerikanischen Gesellschaften. Wie viel respektive wenig die USA und die dort ansässigen Firmen von Datenschutz halten, ist seit langem bekannt. Dass sie ihre Rechtspraxis aufgrund eines Vorstosses der Zürcher SVP-Nationalrätin Fehr-Düsel anpassen würden, darf wohl als eher unrealistisch eingestuft werden.

Auch die Jung-SVP-Präsidentin des Kantons Zürich. Naemi Dimmeler, versucht aus der Geschichte politischen Profit zu schlagen. Auf 20minuten.ch kritisiert sie, dass der Täter von Küsnacht trotz einer Haftstrafe von 12.5 Jahren bereits nach sieben Jahren wieder auf Bewährung freigelassen wurde und fordert gemäss der Zeitung: «Eine verkürzte Freiheitsstrafe darf in solchen Fällen nicht möglich sein.» Die ersten Aussagen sind klar falsch: Zum einen wurde der Mann rechtskräftig nicht zu 12.5, sondern zu 12 Jahren verurteilt. Nach sieben Jahren, also Ende 2021, befand sich der Täter aktenkundig in einer Massnahme und profitierte lediglich von Vollzugserleichterungen. Dass Straftäter in der Schweiz nach Verbüssen von zwei Dritteln der Strafe und bei guter Führung sowie einer guten Prognose auf Bewährung freikommen können, ist breiter Konsens in der Strafrechtspflege.
Art. 112 StGB. Mord
Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.
Art. 111 StGB. Vorsätzliche Tötung
Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.

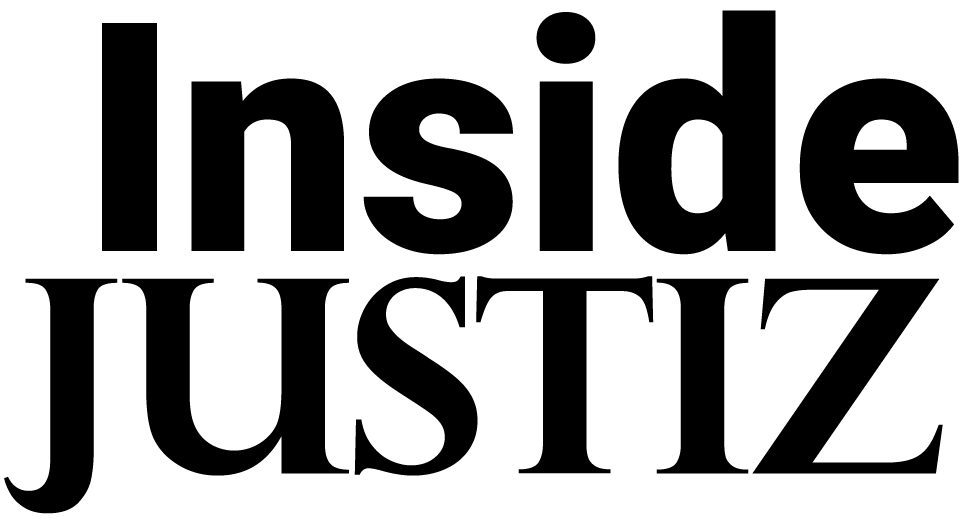
„Der TAGES-ANZEIGER bezichtigt den Mann also eines Straftatbestandes, den er nicht begangen, für den er nie angeklagt und schon gar nicht verurteilt wurde.“
Indem auch die NZZ am Sonntag und 20Minuten.ch den falschen Begriff „Mörder“ übernehmen, setzen sich alle 3 Medien dem Verdacht der Verleumdung aus. Das ist strafbar – zumindest in einem Rechtsstaat …
Die Systemmedien boulevardisieren und skandalisieren ihre Berichterstattung offenkundig, um mehr Klicks und Auflage zu generieren. Journalistische Sorgfaltspflichten? Egal. Ausserdem gibt es ja nur noch 3 grosse Medienhäuser in der Schweiz: TX Group (Tamedia), Ringier und CH Media, die den Markt weitgehend kontrollieren und damit die Berichterstattung steuern bzw. manipulieren können:
https://www.schweizer-standpunkt.ch/news-detailansicht-de-schweiz/verlage-wollen-steuerzahler-zur-kasse-bitten.html
Gleichzeitig bieten die Systemmedien Justizvertretern (z.B. ehemaligen Bundesrichtern) mit Interviews eine Selbstdarstellungsplattform, die dann öffentlich den Rechtsstaat beschwören und sich als deren Hüter aufspielen (dürfen), und so von ihren bewussten Rechtsbrüchen ablenken, die sie als Richter begangen haben. Das ist politische Propaganda wie in einem autoritären System.
Gäbe es keinen kritischen unabhängigen investigativen Journalismus, würde die Öffentlichkeit von solchen Schweinereien kaum etwas erfahren. Deshalb danke an Plattformen wie inside-justiz.ch!
Grundsätzlich mit allem einverstanden, Bin einfach nicht sicher, ob es für eine Verurteilung wegen Verleumdung reichen würde. Ein Mord ist ja eine besonders skrupellose Tötung, und das war m.E. eigentlich ja schon erfüllt – auch wenn die Juristen ihre Gründe haben werden, warum das hier nicht zum Tragen kam.
Aber tatsächlich, von professionellen Journalisten dürfte man ja eigentlich schon erwarten, dass sie den Unterschied kennen. Ich vergleiche beim alltäglichen Lesen die Texte in den Medien meist nicht so präzise, wie das hier getan wird. Aber es ist schon schockierend, wie die Fakten verdreht werden. Und offenbar gibt es bei allen diesen Blättern keine Instanzen, die einen Artikel kontrollieren, bevor er rausgehauen wird. Und sich dann wundern, wenn immer weniger Menschen bereit sind, dafür etwas zu bezahlen…